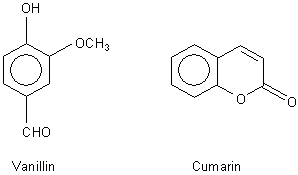
Biologische Süße ohne Zucker
Zucker (Saccharose) gerät immer mehr ins Gerede. Man macht seinen Konsum sowie den von Fructose für das vermehrte Aufkommen von Dickleibigkeit bis zur Zuckerkrankheit und vielleicht sogar für Krebs verantwortlich. Man sucht deshalb nicht erst heute nach Alternativen.
Neben den klassischen Süßmitteln Saccharose, Zuckercouleur und Fructose sowie Honig stieß man zunächst auf die technisch hergestellten Süßstoffe. Diese hatten aber viele Nachteile - u. a. hinsichtlich der kontrovers diskutierten toxischen Eigenschaften und der daraus resultierenden Akzeptanzprobleme.
So besann man sich auf süß schmeckende Substanzen biologischen Ursprungs. Davon waren einige schon lange bekannt - auch im Chemieunterricht: So weiß mancher Schülere, dass Aminosäuren wie Glycin (griech. glykeros, süß) oder L-Asparagin sowie die Mehrfachalkohole wie Glycerin süß schmecken.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es einige andere süßliche Substanzen gibt wie das klassische Vanillin oder wie Cumarin, das im Waldmeister oder auf gemähten Kleewiesen (Frage 1970) vorkommt. Wichtig ist jedoch, dass diese Substanzen nicht süß schmecken, sondern nur süß duften.
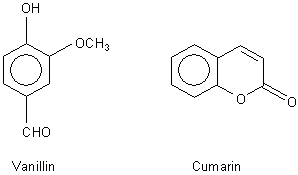
Zuvor müssen wir eine Frage klären: Wie kommt es, dass chemisch so unterschiedliche Substanzen allesamt süß schmecken?
Was ist das Gemeinsame an ihnen? Süßende Stoffe müssen nur bestimmte sterische Anforderungen hinsichtlich der Einpassung
in die entsprechenden Nervenrezeptoren erfüllen. So ist die L-Form des Asparagins süß, während die D-Form ohne Geschmack ist
(-> Frage-Antwort Nr 1968). Hinzu kommt, dass die passenden Substituenten auch über
bestimmte Polaritäten verfügen müssen. Geeignete Substituentenpaare sind z. B. R-COO- / R-NH3+
im Glycin oder R-NH / R-SO3- im Cyclamat.
Besonders interessant sind bestimmte, süß schmeckende Proteine. Nimmt man Lösungen von Curculin zu sich, so verschwindet der Geschmack nach kurzer Zeit. Wenn man den Mund mit Wasser ausspült, schmeckt es wieder süß. Man vermutet, dass der Verlust an Süße mit der Aufnahme von zweiwertigen, im Speichel enthaltenen Erdalkalimetall-Ionen durch das Protein zusammenhängt. Durch Wasser wird der Speichel stark verdünnt, die Mg2+ - und Ca2+ -Ionen werden auf diese Weise vom Curculin abgelöst, wodurch es wieder süß schmeckt.
Ein anderes Protein mit dem passenden Namen Miraculin (lat. miraculum, Wunder) ist zunächst ohne Geschmack. Spült man mit dessen Lösung den Mund aus und trinkt man ungesüßten Zitronensaft, so schmeckt dieser, als wäre er gesüßt.
Neben diesen „richtig“ natürlich anmutenden Substanzen gibt es noch eine Vielzahl süß schmeckender Naturstoffe, die zu den zyklischen oder aromatischen Kohlenstoffverbindungen zählen und die gar nicht nach „gesunden“ Naturstoffen aussehen.
Ein süßendes Derivat eines isomeren Cumarins (Dihydro-Isocumarin) ist das Phyllodulcin (griech. phyllos, Pflanze, lat. dulce, süß; also „Pflanzensüße“). Seine Süßkraft ist etwa das 250fache deren von Saccharose.
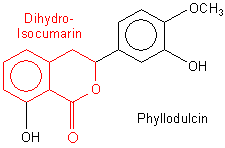
Man muss darauf hinweisen, dass es je nach Substituenten-Anordnung verschiedene Isomere des Phyllodulcins mit stark
unterschiedlicher Süßkraft gibt.
Das trifft auch für einen weiteren süßen Naturstoff zu, das Neohesperidin-Dihydrochalcon. Es besitzt optimal eine Süßkraft, die etwa 1100 Mal höher liegt als die von Saccharose.
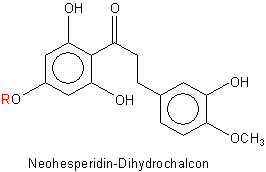
Die Struktur leitet sich deutlich von den Flavonen ab, deren geöffnete Ringverbindungen
heißen Chalcone. In unserem Fall heißt das Ausgangs-Flavon Neohesperidin. Der mit R gekennzeichnete Rest
besteht aus einem Disaccharid (gebildet aus Mannose und Glucose).
Zu den pflanzlichen Süßstoffen gehört auch Glycyrrhizin, das Prinzip der Süßwurzel, das wir vom Lakritz her kennen.
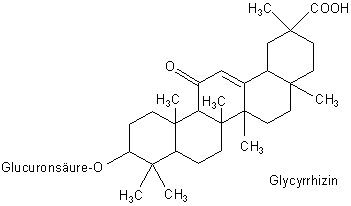
Die toxischen Eigenschaften aufgrund sterischer Ähnlichkeit mit den Cortison-Hormonen erlauben aber nur den begrenzten
Einsatz der Süßwurzel.
In letzter Zeit wird vor allem das Süßmittel Steviosid diskutiert, das in den Blättern einer südafrikanischen Pflanze (Stevia rebaudiana) mit einem Anteil von etwa 6 % enthalten ist.
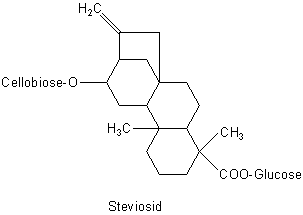
Steviosid trägt als Substituenten bekannte Kohlenhydratreste; einmal den Rest der Glucose und dann den der Cellobiose, dem ß-Analogen der Maltose.
Auch bei den Inhaltsstoffen der Stevia wird noch über mögliche Toxizität diskutiert.
Literatur:
H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle: Lehrbuch der Lebensmittelchemie; Springer-Verlag, 6. Auflage,
Berlin Heidelberg New York 2008.
Weitere Texte zum Thema „Kohlenhydrate“