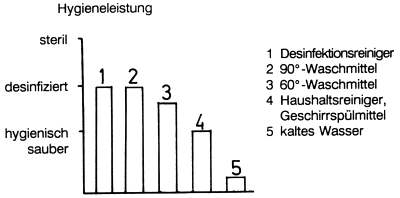
1 Einführung
Produkte zur Reinigung und Pflege von Wäsche, Geschirr, Boden- und Wandflächen oder anderem Reinigungsgut sind Bestandteile des täglichen Lebens. Man unterscheidet zwischen Waschmitteln und Reinigungsmitteln. Waschmittel werden ausschließlich zum Waschen verwendet, während für Reinigungsmittel sehr verschiedene Anwendungen möglich sind. Ein wesentliches und gemeinsames Charakteristikum dieser Haushaltschemikalien ist ihre regelmäßige Anwendung und die damit einhergehende wiederholte und andauernde Exposition des Anwenders sowie der Eintrag in Form von Abfallstoffen in die Umwelt. Unter dem Aspekt der Abfallstoffe kommt noch die große Menge an Einwegverpackungen hinzu.
Hieraus ergeben sich für die Produkte und an die Hersteller spezifische Forderungen. Diese betreffen den positiven Beitrag zur Sauberkeit, Hygiene und Pflege, die gesundheitliche Unbedenklichkeit für den Anwender, aber auch die Verträglichkeit der Produkte und der Verpackungen für die Umwelt. Letzteres gilt für alle Phasen des Produktzyklus von der Herstellung bis zum Gebrauch und zur Entsorgung.
Mengenmäßig dominiert bei den Haushaltschemikalien der Verbrauch der Waschmittel, gefolgt von Spülmitteln und Allzweckreinigern. Mit diesen Produkten und anderen Haushaltsreinigern belastete jeder Haushalt der Bundesrepublik 1985 die Umwelt mit etwa 12 kg Tensiden, fast der gleichen Menge Stellmittel, 7 kg Alkali (Triphosphat), 6 kg Bleichmittel (Perborat), 3,5 kg Enthärter (Silicate) und weiteren organischen und anorganischen Chemikalien in geringeren Mengen [7].
Der Gesetzgeber verlangt im Waschmittelgesetz von 1975, novelliert am 1. Januar 1987, eine Mindestabbaubarkeit von 80 % der in Wasch- und Reinigungsmitteln enthaltenen anionischen und nichtionischen Tenside (-> 4.18). Dies allein kann aber nicht ausreichend sein. Wünschenswert ist vielmehr eine bessere Informiertheit der Berater und Verbraucher, die durch ihr Kaufverhalten die Entwicklung immer besserer Wasch- und Reinigungsmittel vorantreiben.
1.1 Literaturempfehlung
Über Waschmittel und Haushaltsreiniger gibt es eine Flut von Veröffentlichungen auf
jedem wissenschaftlichen Niveau. Hier fließen auch viele Tagesaktualitäten ein,
auf die in diesem Skript nicht eingegangen werden kann. Die folgenden Bücher geben
einen ausreichenden Einblick über die wichtigsten physikalischen, chemischen und toxikologischen
Grundlagen.
Eine Einführung, die aber wissenschaftliche Ansprüche nicht
erfüllen kann, sowie einen umfassenden Überblick über den
aktuellen Markt für Wasch- und Reinigungsmittel, der aber
wissenschaftliche Ansprüche nicht erfüllen kann, liefert das
Taschenbuch "Öko-Test Ratgeber Waschen und Putzen" von I.
Brodersen und F. Duve (Hg.), erschienen bei Rowohlt 1989 [12]. Ein gutes Buch zum Nachschlagen für die Haushaltschemie, nicht
nur unter dem Aspekt der Wasch- und Reinigungsmittel, gibt die
Katalyse Umweltgruppe mit dem Titel "Chemie im Haushalt",
erschienen bei Rowohlt 1984, heraus [11]. Die Zusammensetzung und Wirkungsweise von Haushaltschemikalien wird
gut verständlich und umfassend in dem Taschenbuch
"Chemische Produkte im Alltag" von G. Vollmer und Manfred
Franz, erschienen bei Thieme 1985, dargestellt [5]. In diesem
Buch wird auch auf chemische Sachverhalte ausreichend
ausführlich eingegangen. Leider fehlen in der Auflage von 1985
einige der neuesten Entwicklungen zum Thema. Vertiefende Informationen über Waschmittelbestandteile, die von
der Rohstoffauswahl über die Produktion bis zu Rezepturen und
Umweltaspekten reicht, liefert das in Englisch geschriebene Buch
"Surfactants in Consumer Products" von J. Falbe (Hg.), erschienen
bei Springer 1987 [7]. Der Herausgeber ist Chef der Henkel KGaA,
dem bedeutendsten deutschen Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln
auf der Basis nachwachsender Rohstoffe.
1.2 Hygieneanforderungen im Haushalt
Der Wasch- oder Reinigungsvorgang ist unter ökologischem Blickwinkel ein Recycling von Wäsche bzw. von Reinigungsgut. Dabei wird Schmutz in gelöster oder in ungelöster Form von der zu reinigenden Oberfläche entfernt und meist vom Lösemittel Wasser abtransportiert. Die zu reinigende Oberfläche sollte anschließend einen Zustand erreicht haben, der mit "hygienisch sauber" umschrieben werden kann.
Was "hygienisch sauber" bedeutet, ist objektiv nur schwer zu definieren. Die Werbung setzt das Ziel aus ökonomischem Interesse sehr hoch an. Dabei wird das erforderliche und sinnvolle Maß an Hygiene im Haushaltsbereich oft erheblich überschritten. Dies führt beim Anwender teilweise zu falschen Vorstellungen über die tatsächlich notwendige Hygiene und die Bereiche im Haushalt, die besonderer hygienischer Beachtung bedürfen.
Der Hygienezustand "hygienisch sauber" reicht für alle Bereiche im Haushalt, beispielsweise für das Waschen und Geschirrspülen völlig aus. Der erreichbare Hygienezustand hängt von der Art des Reinigers, der Einwirkdauer und der Temperatur ab (-> Abb. 1).
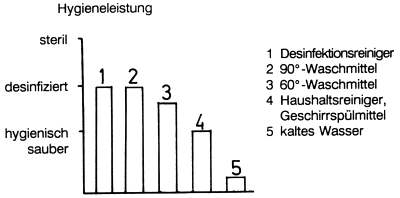
Eine übertriebene Hygiene ist nicht nur unnötig, sondern sogar schädlich. Dies bezieht sich nicht alleine auf den erhöhten Chemikalieneintrag in die Umwelt. Ebenso nimmt die Chemikalienmenge zu, denen sich alle Haushaltsmitglieder permanent aussetzen. Damit ist ein Aspekt angesprochen, der gerade angesichts der immer zahlreicher werdenden Allergiefälle in den hochindustrialisierten Industrieländern zu berücksichtigen ist. So wird in der deutschen Apotheker-Zeitung ein Zusammenhang zwischen intensiver Teppichpflege und dem so genannten Kawasaki-Fieber hergestellt [16].
Die Abtötung von Mikroorganismen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten kann ebenfalls nicht das Ziel von Haushaltsreinigung sein. Die Beseitigung aller ubiquitären Mikroorganismen kann mit Haushaltsmethoden ohnehin kaum erreicht werden. Und falls man durch intensive Anwendung desinfizierender Reiniger die häusliche Keimbelastung dennoch stark vermindert, hat dies bereits nach dem Verlassen des Hauses keine Bedeutung mehr. Im Übrigen nimmt die Belastbarkeit der körpereigenen Immunabwehr ab, wenn man in keimreduzierter Umgebung wohnt. Dadurch steigt die Empfindlichkeit des Körpers und das Risiko von Infektionen.
Anhand von drei Beispielen sollen typische Fehler in der Haushaltshygiene besprochen werden:
Beispiel 1: Geschirrspülen
Da Spülmittel den mengenmäßig größten Anteil an
den Haushaltsreinigern haben und gerade hier oft falsche Vorstellungen von der
erreichbaren Hygiene vorherrschen, soll auf die Hygiene beim
Geschirrspülen kurz eingegangen werden. Beim Abtrocknen erhöhen
mehrfach gebrauchte Trockentücher die Keimbelastung auf
dem Geschirr erheblich. Dies entfällt, wenn man die
Geschirrtücher nicht erst bei deutlich sichtbarer Verschmutzung
wechselt. Die beste Hygiene erreicht man, wenn das Geschirr an
der Luft getrocknet wird. Der dabei auf dem Geschirr verbleibende
Spülmittelfilm ist mit einer durch die anschließende Benutzung
aufgenommenen Tensidmenge von 0,1 g pro Person und Jahr
unbedenklich und viel geringer als beispielsweise die durch
Zähneputzen in den Körper gelangenden Tensidmengen.
Es ist unnötig und teilweise sogar schädlich, den Hygienezustand über "hygienisch sauber" hinaus zu erhöhen. Dieses Ziel wäre nur mit erheblich erhöhtem Aufwand und größerer Umweltbelastung durch Wasch- und Reinigungsmittel zu erreichen.
Beispiel 2: Waschen
Die Keimbelastung von Kochwäsche ist mit der Keimbelastung von
60 °C-Wäsche vergleichbar, wenn nach dem Waschvorgang die
Arbeitsweisen gleichartig sind, also die Wäsche von Hand aus der
Maschine entnommen und im Garten getrocknet wird. Eine
Sterilisation von Wäsche muss nur im Krankenhaus erfolgen. Dies
ist nicht die Aufgabe einer normalen Kochwäsche. Es wird aber
aufgrund der unrichtigen Hygienevorstellung viel Wäsche gekocht,
die mit weniger Energieaufwand und schonender bei 60 °C
gewaschen werden könnte.
Bei weißer Wäsche kommt noch eine Fehleinschätzung hinzu, die durch die subjektive Farbwahrnehmung entsteht. Westeuropäern ist ein anderes Weißempfinden anerzogen als Nordamerikanern. Während Nordamerikaner ein gelbliches weiß als reinweiß betrachten, ist es für Westeuropäer ein bläuliches weiß. Ein Westeuropäer würde also ein hygienisch sauberes gelblich weißes Wäschestück als noch unsauber betrachten, obwohl es für einen Amerikaner einwandfrei "reinweiß" wäre. Hierzulande wird diesem Weißempfinden durch unnötige Aufheller (-> 4.2) Rechnung getragen.
Beispiel 3: Reinigung von Bad und Küche
In diesem Beispiel soll ein weit verbreiteter Irrtum bezüglich der
Haushaltshygiene angesprochen werden. Unter dem
Gesichtspunkt der Hygiene ist die Küche und nicht etwa das Bad
der Problembereich, der die größte Sorgfalt erfordert. Gerade hier
werden Reinigungsanstrengungen fehlgeleitet, weil das Gefühl
vorherrscht, dass Toilette und Bad durch Körperausscheidungen
und die hohe Dauerfeuchtigkeit besonders keimbelastet seien. Es
ist aber so, dass sich Mikroorganismen gerade in der Küche durch
das ausreichende Nahrungsangebot sehr gut vermehren.
1.3 Wasch- und Reinigungsfaktoren
1.3.1 Der Reinigungskreis nach Sinner
An jedem Reinigungsvorgang sind neben dem Lösemittel (meist Wasser, seltener organische Lösemittel) fünf Faktoren beteiligt, nämlich Mechanik, Chemie, Zeit, Temperatur und Biologie, wobei die Reihenfolge der Aufzählung keine Wertung bedeutet. Die fünf Faktoren sind wechselseitig voneinander abhängig. Das heißt, dass bei jedem Reinigungsvorgang die Gewichtung der Faktoren unterschiedlich sein kann. Die Anwendung von Chemie beim Waschen und Reinigen kann vermindert werden, wenn dafür andere Reinigungsfaktoren, beispielsweise die Einwirkdauer oder die mechanische Reinigungsleistung erhöht werden.
An dieser Stelle sollen die Begriffe "chemischer", "physikalischer"
und "mechanischer" Reinigungsvorgang kurz erläutert werden.
Chemische Vorgänge laufen unter stofflicher Veränderung ab,
z. B. Bleichen (-> 4.4) oder Komplexieren (-> 4.5).
Physikalische Vorgänge laufen ohne stoffliche Veränderung ab, z. B. Lösen (->
4.10) oder mechanische Reinigung. Da man die Vorgänge kaum
trennen kann, z. B. werden physikalische Vorgänge durch
Chemikalien (-> 4.1.2 und 4.18) unterstützt, spricht man beim
Waschen und Reinigen von "physikalisch-chemischen"
Vorgängen.
Im Reinigungskreis von Sinner (-> Abb. 2) sind mit Chemie alle den Wasch- und Reinigungsvorgang unterstützenden Chemikalien mit Ausnahme von Wasser gemeint. Dabei ist es gleichgültig, ob der Wirkmechanismus chemisch oder physikalisch ist. Mechanik umfasst alle Einwirkungen wie Reiben, Rühren, Schütteln, Wischen. (Sinner war übrigens Tensid-Chemiker bei der Fa. Henkel in Düsseldorf.)
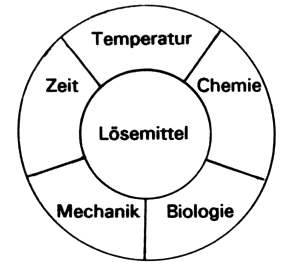
Das Zusammenwirken der oben genannten fünf Reinigungsfaktoren kann am Beispiel des Geschirrspülens anschaulich erklärt werden, indem man den Handgeschirrspülvorgang mit dem Maschinengeschirrspülvorgang vergleicht (-> Abb. 3):

Spült man von Hand und nur mit kaltem Wasser (Temperatur), muss man sehr viel Arbeit (Mechanik) aufbringen und lange reiben oder scheuern. Die Verwendung von handwarmem Wasser und der Zusatz von Spülmittel (Chemie) verringert den Zeitbedarf und den Bedarf an Mechanik. Die Bedeutung der mechanischen Reinigungsleistung wird besonders im Vergleich mit dem maschinellen Geschirrspülen deutlich: Im Gegensatz zum Geschirrspülen von Hand erbringt eine Geschirrspülmaschine außer den schwachen Wasserstrahlen keine mechanische Reinigungsleistung. Damit das Geschirr trotzdem sauber wird, erfolgt der Reinigungsvorgang bei einer höheren Temperatur (ca. 50-70 °C statt 45 °C) und unter Verbrauch der etwa vier- bis sechsfachen Menge Geschirrspülmittel und zusätzlich Klarspüler und Regeneriersalz. Außerdem ist pro Geschirrteil, das ja bis zum Ende der Reinigung in der Geschirrspülmaschine verbleibt, die Reinigungszeit erheblich länger als beim Geschirrspülen von Hand.
Fazit: Der Reinigungsfaktor Mechanik der vergleichsweise wenig umweltbelastend ist, wird bei der Spülmaschine durch Chemie, Temperatur (Energie) und eine längere Reinigungszeit ersetzt. Unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit ist eine Spülmaschine also in jedem Fall ein Rückschritt, auch dann, wenn in Testzeitschriften der geringe Wasserverbrauch von Spülmaschinen gelobt wird, der teilweise sogar geringer sein soll als beim Handgeschirrspülen. Dieser letzte Punkt, der im Übrigen nur bei voller Auslastung der Spülmaschine in jedem Spülgang zutrifft, kann aber nur ein Teilaspekt in der Gesamtbeurteilung sein. Negativ geht auch der hohe Rohstoff- und Energieverbrauch bei der Herstellung von Spülmaschinen in die Umweltbilanz ein.
1.3.2 Physikalisch-chemische Aspekte beim Reinigen
Betrachtet man den Reinigungsvorgang unter physikalisch-chemischen Aspekten, so besteht er aus zwei Schritten.
Erster Reinigungsschritt:
Entfernung (Ablösung) der Schmutzteilchen von der
verschmutzten Oberfläche.
Dies kann auf mehrere Weisen erfolgen:
| - | Durch Lösen des Schmutzes im Reinigungsmittel. |
| - | Durch mechanisches Ablösen des Schmutzes von der Oberfläche (z. B. durch Reiben). |
| - | Durch eine chemische Reaktion (z. B. durch Bleichen). |
Zweiter Schritt:
Abtransport der Schmutzteilchen.
Dazu muss der Schmutz in einer transportfähigen Form vorliegen.
Das bedeutet, dass der Schmutz entweder gelöst, dispergiert oder
emulgiert vorliegen muss.
Die beiden Schritte Ablösung und Abtransport der Schmutzteilchen werden im Kapitel "Tenside" (-> 4.18) besprochen.