 |
| Bild 1: Laubfrosch
(Foto: Blume) |
Überleben von Tieren im zugefrorenen Teich
 |
| Bild 1: Laubfrosch
(Foto: Blume) |
Das Überleben von Wassertieren im zugefrorenen Teich hat die Dichteanomalie
des Wassers zur Voraussetzung.
Zunächst einmal hat die geringe Dichte von Eis zur Folge, dass Teiche nie von unten
her, sondern von oben her zufrieren. Das Eis garantiert an seiner Grenze zum Wasser
die Gleichgewichtstemperatur von 0 °C, egal wie kalt es "draußen" ist. Hinzu kommt,
dass Eis ein hervorragendes Isoliermaterial ist. Die Eisdecke isoliert das Wasser mit
zunehmender Dicke immer besser gegen weiteren Wärmeverlust. Es bilden sich unter
unseren irdischen Bedingungen deshalb höchstens etwa 75 cm dicke Schichten.
Diese schirmen nicht nur die Kälte ab, sondern sind außerdem für die Fotosynthese
durch Algen ausreichend lichtdurchlässig, so dass auch unter diesen Bedingungen
Sauerstoff produziert werden kann.
Unter der Eis/Wasser-Grenze steigt die Temperatur mit der Tiefe des Sees an, um bei
etwa 1,20 m stehen zu bleiben. Jetzt ist der Eigendruck auf das Wasser so groß, dass
es sein Minimalvolumen erreicht. Damit verbunden ist die Temperatur von 4 °C. Egal
wie hoch der Druck wird: Das Wasser hat seine dichteste Struktur erreicht und die
damit verbundene Temperatur kann nicht 4 °C unterschreiten, aber auch nicht
überschreiten. Dann müsste ja das Volumen des Wassers zunehmen. Deshalb sind
ausreichend tiefe Oberflächengewässer, Meere und Ozeane ohne sonderliche
Strömungen in größeren Tiefen immer 4 °C kalt - oder 4 °C warm, wenn man so will.
Bei diesen Temperaturen fühlen sich Fische und andere Lebewesen recht wohl.
Die Konsequenz aus der Anomalie des Wassers: Tiefere Seen und Meere frieren
nach unten hin nie ganz zu. Es gibt genug Raum für das Leben, wenn auch manchmal
nur für Leben im Schneckentempo. Wasser garantiert also ideale Bedingungen für
das Leben im Wasser - nicht nur in den Ozeanen der Polarregion, sondern auch im
Goldfischteich.
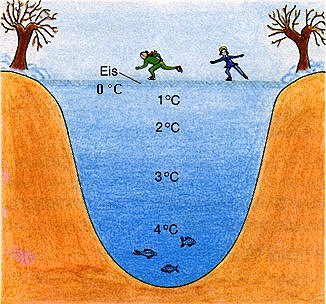 |
| Bild 2 (Quelle: Cornelsen) |
Allerdings hat die Dichteanomalie auch negative Auswirkungen auf das Leben im
Teich: Die Schichtung des Wassers kann bei stehenden Gewässern dazu führen, dass
ein kontinuierlicher Stoffaustausch zwischen den Zonen unterbleibt. Daher neigen
stehende Gewässer zum "Umkippen", d. h. zur Ausbildung sauerstoffarmer und
deshalb lebensfeindlicher Zonen. Das ist vor allem bei Seen mit viel
Pflanzenwachstum der Fall. Paradoxerweise versorgen die Wasserpflanzen den See
nicht mit Sauerstoff, wie sie es für die Atmosphäre tun. Denn aufgrund des schnellen
Wachstums (z. B. wegen Düngereintrag) sterben sie auch rascher ab. Beim Verwesen der
Biomasse wird durch die Bakterien übermäßig viel Sauerstoff verbraucht. Es bilden
sich reduzierende Verhältnisse aus. Dadurch entstehen Methan, Schwefelwasserstoff
und Phosphin (PH3). Letzteres entzündet sich spontan beim Kontakt mit
Luftsauerstoff. Hierauf beruhen die Legenden von den Flämmchen und Geistern im Moor.
Lies hierzu:
Wie Bakterien anaerob leben und dabei Eisensulfid produzieren.
Weitere Texte zum Thema „Wasser“