Prof. Blumes Tipp des Monats Mai 2000 (Tipp-Nr. 35)
Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis
unbedingt beachten.
Wir sitzen Ostermontag im "Stellwerk", einer gemütlichen Studentenkneipe in
Bielefeld-Brake, lassen die ICEs an uns vorbeisausen und denken nach: Was könnte der Tipp
des Monats Mai werden? Christel sagt: Zum Monat Mai passt die ...
Maibowle!
 |
| Bild 1: Waldmeister (Foto: Blume) |
Es stimmt: Was wäre eine zünftige Maitags-Fete ohne alkoholische Extrakte von frisch
gesammelter Asperula odoratua (oder
Galium odoratum), also von
Waldmeister. Wichtig: Nur diejenigen Stängel
und Blätter duften nach Waldmeister, die noch keine Blüten haben. Und Kenner schwören darauf,
dass der Waldmeister einen Tag nach dem Abpflücken liegen (also welken) soll, um sein volles Aroma
zu entfalten. Woran das liegt, erklären wir weiter unten. Hier ist das Rezept für das Getränk, wie
wir es im Internet in einer mittlerweile nicht mehr anklickbaren Webseite gefunden haben:
|
Versuch: Herstellen von Maibowle
Wohl bekomm´s! |
Irgendwas ist ja immer!
Typische Folgen ungehemmten Trinkgenusses von Maibowle sind heftige Kopfschmerzen,
Erbrechen, Schwindel und Müdigkeit. Diese befallen auch geübte Trinker. Ist da
vielleicht mehr als nur Alkohol drin? Du wirst vielleicht misstrauisch geworden sein: Da
ist der Hinweis auf Gift-Pflanzen im Rezept! Das betrifft Salbei (wegen des Absinth-Thujons),
aber vor allem auch den guten, deutschen Waldmeister.
Richtig vermutet: Waldmeister enthält einen Stoff, der nicht nur für die
pharmazeutische Industrie wegen seiner physiologischen Wirkungen von höchstem Interesse ist:
Cumarin.
Der Geruch von Cumarin ist der von Waldmeister; aber auch frisch gemähtes Gras oder trockenes Heu haben diesen etwas an Vanille erinnernden süßen Duft. Denn Cumarin findet man auch in vielen Kleearten.
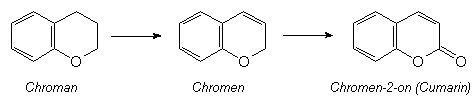
Chemisch ist Cumarin Chromen-2-on. Es leitet sich vom Chroman ab. Es wird in verschiedenen Pflanzen durch Cyclisierung von cis-2-Hydroxyzimtsäure (Cumarinsäure) gebildet. Es ist also deren innerer Ester, ein Lacton.
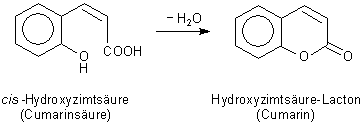
Weil die Cyclisierung spontan abläuft, liegt die Cumarinsäure in der unverletzten Pflanze als Glykosid vor, hat also die phenolische Alkoholgruppe mit einer Schutzgruppe (einem Zuckerrest) versehen. Vor der Cyclisierung muss diese Schutzgruppe abgespalten werden. Das geschieht enzymatisch durch spezielle Hydrolasen, die aktiv werden, wenn Pflanzen verletzt worden sind. Das betrifft nicht nur Waldmeister. Deshalb riechen auch viele frisch gemähte Wiesen nach Cumarin. Dadurch schützen sich die Pflanzen vielleicht vor weiteren (Biss-)Verletzungen.
Nun verstehen wir aber auch, warum man (wie oben erwähnt) den frisch geschnittenen Waldmeister etwas welken lassen sollte, bevor man ihn zur Maibowle gibt: Er entwickelt dadurch besonders viel Cumarin.
Das heterocyclische Doppelringsystem kennst du vielleicht schon von den Anthocyanen, den Blüten- und Blattfarbstoffen her (siehe Webseite zum Rotkohlsaft).
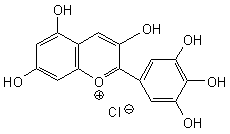
Delphinidin, das Anthocyan des Rittersporns (Delphinium)
Cumarin ist ein ganz besonderer Stoff!
1 Wenn man ihn zu sich nimmt, beobachtet man genau
die Wirkungen, die bei zuviel genossener Maibowle auftreten. In höheren Dosen
(per oral um 500 mg/kg Lebendgewicht) ist Cumarin
sogar tödlich. Bei kleineren Mengen treten außerdem Leber- und Nierenschädigungen
auf. Diese beruhen wohl auf dem Abbauprodukt
o-Hydroxy-Phenylessigsäure.
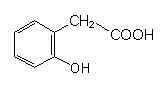
o-Hydroxy-Phenylessigsäure
2 Bakteriell kann aus Cumarin bzw. aus der Cumarinsäure auch Dicumarin (Dicumarol) entstehen. Dicumarin entsteht deshalb auch beim Faulen von kleehaltigem Heu. Man hat beobachtet, dass Kühe, die davon fraßen, an inneren Blutungen eingingen. Da auch Ratten rasch verbluten, wenn sie davon gefressen haben, hat man daraus Rattengift hergestellt. Da es den Ratten offenbar gut schmeckt, ist es ein recht erfolgreiches Mittel.
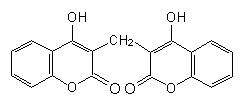
Dicumarin (Dicumarol)
Die Formel von Dicumarin zeigt, wo der Stoff seine gerinnungshemmende Wirkung entfaltet. Er weist Analogien zum Vitamin K auf. Das ist eine der Komponenten, die zur Auslösung der Blutgerinnung notwendig sind. Es wirkt bei der Synthese von Prothrombin in der Leber mit. Offensichtlich besetzt Dicumarin die Rezeptoren von Vitamin K, ohne seine physiologische Wirkung zu besitzen.
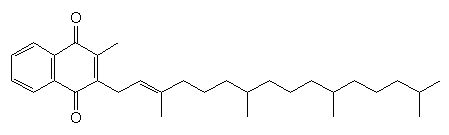
Vitamin K1 (Phyllochinon)
Phenprocoumon ist ein Stoff, der in der Apotheke als Marcumar® zu kaufen ist. Das ist ein gerinnungshemmender Stoff, den man nach Herzinfarkten verabreicht.
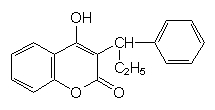
Phenprocoumon (Marcumar)
Auch hier wird die Analogie zu Vitamin K deutlich.
3 Das heterocyclische Ringsystem Chromen ist aber auch Bestandteil von photosensibilisierenden Stoffen wie die Furanocumarine (Furocumarine). Das sind Chromene mit ankondensierten Furanringen:
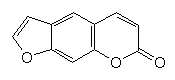
Psoralen, ein Furocumarin
Man findet sie vor allem in Doldenblütlern. Ein Beispiel ist das Psoralen. Es kommt in Sellerie und Petersilie vor. Es greift im Verlauf seiner Bestrahlung sogar die DNA an und wirkt cancerogen. Berüchtigt sind auch die Furocumarine im Bärenklau (Heracleum). Dessen großer Bruder ist die bis zu 3 m hohe Herkulesstaude. Erstere löst das relativ harmlose Wiesenekzem aus. Letztere ist nicht nur die weitaus größere Pflanze, sondern auch viel heftiger in der Wirkung: Kontakt mit ihrem Saft führt bei gleichzeitiger Exposition in Sonnenlicht zu Verbrennungen dritten Grades! Hier hilft nur: Gut abwaschen und Sonnenbestrahlung unbedingt vermeiden.
Klick mich an!
Bild 2: Herkulesstaude (Foto: Blume))
| Bild 2: Herkulesstaude (Foto: Blume) |
(Weitere Informationen erhältst du aus der Giftzentrale:
http://www.giftinfo.uni-mainz.de/)
4 Chromene sind auch in den cancerogenen Pilzgiften enthalten. Hier ist besonders das Aflatoxin zu nennen, ein gelber Farbstoff des Brotschimmelpilzes. Es gehört zu den Naturstoffen mit dem höchsten Krebsauslösungspotential.
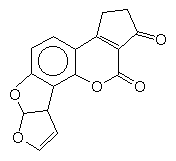
Aflatoxin
5 Cumarin leuchtet unter UV-Bestrahlung blau auf; es fluoresziert also. Deshalb nutzt man es und seine Derivate als optische Aufheller, die man Waschmitteln zusetzt. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass nur oral aufgenommenes Cumarin giftig ist.
Wofür brauchen Pflanzen Cumarin?
Schafe fressen keine Pflanzen, die nach Cumarin riechen. (Glücklicherweise verdampft es rasch,
da es gut wasserdampfflüchtig ist.)
Dient Cumarin also zur Abwehr von Fressfeinden? Von einem Rüsselkäfer wissen wir wiederum, dass er
von dem Duft angezogen wird. Er findet so seine Lieblingsspeise, den Steinklee Melilotus.
Sicherlich gilt das Abwehrprinzip für Doldenblütler. Hier geht es insbesondere um die Synthese
von Derivaten des Cumarins, die Furocumarine. Deren Phototoxizität wirkt sogar gegen Insekten und
deren Raupen. Manche schützen sich beim Fressen vor Sonneneinstrahlung, indem sie sich in die
Blätter einwickeln.
Das durch UV-Strahlung induzierte mutagene Potential ist Grund dafür, dass Cumarine auch auf
Mikroorganismen toxisch wirken. Es scheint sogar so zu sein, dass aus diesem Grunde bei
Infektionen durch die befallenen Pflanzen im Krankheitsbereich verstärkt Cumarine gebildet
werden. Das ist z. B. bei der Knollenfäule von Kartoffeln sowie beim Apfel-Schorf der Fall.
Müssen wir auf Waldmeister verzichten?
Mal ehrlich: Hast du gewusst, dass in der Maibowle so
viel "Chemie" steckt?
Nach der Essenzen-Verordnung (jawohl, die gibt es!) darf Cumarin
nicht mehr unbegrenzt zum Verfeinern von Speisen oder Getränken genutzt werden. Aber bekanntlich
können wir doch in jedem Supermarkt Speisen wie die beliebte grüne Götterspeise
oder Brausepulver mit Waldmeister-Aroma kaufen. Was ist damit los?
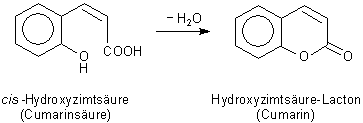
Glücklicherweise gibt es Stoffe, die so ähnlich wie Cumarin nach Waldmeister riechen. So ein
Stoff ist die trans-Form der 2-Hydroxyzimtsäure
(Cumarsäure genannt). Da sie aus sterischen Gründen nicht zum
Cumarin cyclisiert werden kann, ist sie ungiftig und darf als Lebensmittelzusatz verwendet
werden. Außerdem verschneidet man sie noch mit etwas Vanillin. Ein weiterer Ersatzstoff ist
6-Methyl-Cumarin.
Aber auch Cumarin darf noch bei manchen Produkten verwendet werden, da es relativ wenig
toxisch ist. Maximale Konzentrationen liegen zwischen 2 - 10 mg/kg Lebensmittel.
Waldmeister nimmt man nicht nur für die Maibowle
Suchst du im Internet unter Waldmeister, so staunst du, was für Rezepte es
alles gibt, bei denen die kleine Pflanze mit den unscheinbaren, weißen Blüten genutzt
wird. Hier ein Auszug aus der Rezeptsammlung der UNIX-AG an der Uni Kaiserslautern:
- Erdbeeren mit Waldmeister
- Maibowle
- Mistkratzerli in Waldmeistermarinade
- Waldmeister-Bowle I
- Waldmeisterbowle, alkoholfrei
- Waldmeister-Bowle mit frischem Waldmeister
- Waldmeisterlikör
- Waldmeister-Reisauflauf mit Rhabarber
- Waldmeistersirup
- Waldmeistersorbet
(Pardon: Eine Frage an die UNIX-AG: Was ist ein Mistkratzerli? Ist damit etwa ein Mistkäfer gemeint?)
Zum Schluss eine Entwarnung
In der Maibowle sind die bösen Stoffe viel zu verdünnt, als dass sie ihre
Toxizität voll ausspielen könnten. Eher brichst du vom Alkohol zusammen als vom
Waldmeister-Aromastoff Cumarin!
Übrigens: Nach dem Verkosten der selbst hergestellten Maibowle hat Christel noch den
sagenhaften Sokoban-Level 29 geschafft. So giftig kann die Bowle
also nicht sein. Im Gegenteil: Die turnt offenbar mächtig an!
 |
| Bild 3 (Foto: Blume) |
Rüdiger Blume
Literatur
| 1 | Römpp: Chemie Lexikon (u. a. Spezialband Lebensmittelchemie); Thieme-Verlag Stuttgart (neueste Auflage) |
| 2 | H. Beyer: Lehrbuch der Organischen Chemie; S. Hirzel-Verlag Leipzig (neueste Auflage) |
| 3 | J. B. Harborne: Ökologische Biochemie; Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg-Berlin-Oxford 1995 (Eine hochinteressante Einführung in die chemischen Aspekte der Interaktion von Organismen!) |
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 06. April 2011, Dagmar Wiechoczek
