Prof. Blumes Tipp des Monats Mai 2013 (Tipp-Nr. 191)
Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis
unbedingt beachten.
Zur Chemie der Maiglöckchen
Wie reimte Eduard Mörike in seinem Gedicht „Frühling“ so schön?
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte,
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land…
Was überhaupt ist des Frühlings typischer Duft? Viele meinen, es sei der Duft nach Jauche, weil Landwirte zur besten Frühlingszeit ihre Felder düngen. Andere denken an den Duft von blühenden Maiglöckchen (Convallaria majalis).

Bild 1: Gewöhnliches Maiglöckchen - Blüten und Frucht
(Fotos: Blume)
Die vollständige Duftkomposition gibt Chemikern immer noch einige Rätsel auf, denn es handelt sich um ein komplexes Gemisch von allerlei
Substanzen. Aber einige hat man identifizieren können. In vielen Chemiebüchern wie von H. Beyer [4] wird zum Beispiel der Duft des Terpens Farnesol
als „maiglöckchenartig“ beschrieben.
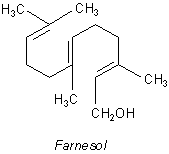
Bei anderen Duftstoffen handelt es sich vor allem um Aldehyde mit zungenbrecherischen Bezeichnungen wie z. B. p-tert-Butyl-α-methyl-hydro-zimtaldehyd.
Zum Vergleich zeigen wir auch die Strukturformel des Zimtaldehyds.
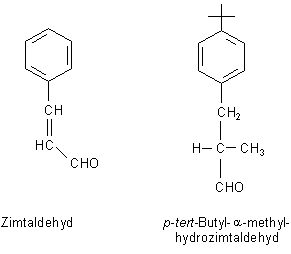
Maiglöckchen als Giftpflanze
Maiglöckchen gelten aber nicht nur als Duftträger, dessen Sträußchen vor allem Bräute und Konfirmandinnen beglücken,
sondern sind auch als Heilpflanze im Bewusstsein verankert. Das liegt daran, dass sie über eine Reihe von Inhaltsstoffen
verfügen, die pharmakologische Wirkungen aufweisen. Das besagt aber leider auch, dass die Pflanze und ihre Früchte nicht
unbedenklich sind. Denn der Grat zwischen gesundheitsfördernd und Giftigkeit ist sehr schmal - vor allem, wenn
es sich um kreislauf- und herzaktive Substanzen handelt. Oft entscheidet nur die Dosis darüber, ob das Herz zu
höherer Aktivität angeregt wird (positiv) oder ob es zum Herzstillstand kommt (negativ).
In diesem Zusammenhang sind vor allem Steroide zu nennen: Convallatoxin und deren Verwandte wie Convallosid.
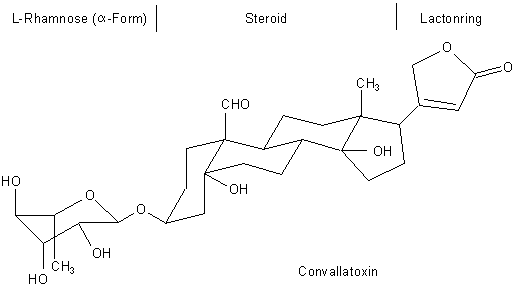
Es handelt sich um Glykoside, also um Verbindungen, die Zuckerreste enthalten. Hier handelt es sich um L-Rhamnose
(wie bei Convallatoxin) und um D-Glucose. Da sie herzwirksam sind, spricht man von Cardenolidglykosiden.
(Ähnliche Substanzen sind auch im Fingerhut (Digitalis) vorhanden: Digitoxin.) Das Steroid des
Maiglöckchens heißt übrigens Strophanthidin und ist bekannt als Inhaltsstoff von unter dem Namen „Hundsgift“
einschlägig bekannten Pflanzen. Die Rhamnose trägt anstelle der für Hexosen typischen endständigen CH2OH-Gruppe
eine Methylgruppe.
Weiter ist im Maiglöckchengift eine untypische Aminosäure enthalten. Sie stört den Proteinsynthesestoffwechsel anderer Organismen. Es handelt sich um Acetidin-2-carbonsäure.
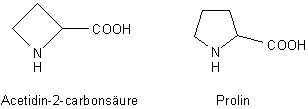
Diese Aminosäure konkurriert mit der proteinogenen Aminosäure Prolin um die transfer-RNA. Trickreich:
Nur die Prolin-transfer-RNA-Syntheseenzyme des Maiglöckchens erkennen dieses Täuschungsmannöver und lassen die
Acetidin-2-carbonsäure draußen vor.
Zur akuten Giftigkeit des Maiglöckchens sei gesagt, dass die Dosis der Gifte schon recht hoch sein muss, damit Vergiftungsfälle mit wirklich schlimmen Folgen eintreten. So ohne weiteres wird ja wohl kaum jemand Blätter, Blüten oder Früchte des Maiglöckchens essen. Aber trotzdem passiert das, nämlich wenn man im Wald Bärlauchblätter sammelt. Diese knoblauchartige Pflanze gehört wie auch das Maiglöckchen zu den Liliengewächsen und wächst und blüht zur gleichen Zeit. Ihre Blätter sehen denen des Maiglöckchens zum Verwechseln ähnlich. Deshalb werden Maiglöckchenblätter beim Sammeln der gesundheitsfördernden Bärlauchblätter mitgepflückt – vor allem, wenn manche Leute die Blätter mit Sensen und Sicheln „ernten“. Man spricht dann wohl von „Kollateralschaden“…

Bild 2: Bärlauch
(Foto: Blume)
Es gibt in unserer Gegend übriges noch mehr Maiglöckchengewächse. Diese sind ebenfalls
toxisch.
Zum Schluss hier das komplette Gedicht von Eduard Mörike:
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte.
Süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!
Mörike, der aus dem Württembergischen stammt, war immer schon ein naturverbundener Dichter. So sammelte er auch Fossilien und widmete dieser Freizeitbeschäftigung sogar ein eigenes Gedicht.
Rüdiger Blume
Literatur:
[1] J. B. Harborne: Ökologische Biochemie; Spektrum Verlag, Heidelberg 1995.
[2] E. Teuscher, U. Lindequist: Biogene Gifte; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 3. Auflage, Stuttgart 2010.
[3] G. Vollmer, M. Franz: Chemische Produkte im Alltag. Thieme, Stuttgart 1985.
[4] H. Beyer: Lehrbuch der Organischen Chemie. S. Hirzel Verlag, Leipzig (neueste Auflage).
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 01. April 2015, Dagmar Wiechoczek