Prof. Blumes Tipp des Monats Juli 2015 (Tipp-Nr. 217)
Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis
unbedingt beachten.
Weshalb man im Urlaub braun wird
Es ist bald Urlaubszeit. Die meisten Leute träumen schon davon, dass ihre Haut braun wird. Denn damit wird dokumentiert, dass sie einen schön sonnigen Urlaub hatten. Und wenn das nicht so war, hilft man mit einem Aufenthalt in einem „Tussigrill“ nach.
Übrigens galt braune Haut früher als höchst unfein, denn das bedeutete ja, dass man richtig arbeiten musste - wie das Landvolk oder wie Handwerker auf dem Bau.
Was eigentlich ist der braune Farbstoff der Haut?
Der Farbstoff heißt Melanin (griech. melos, braun, schwarz). Es handelt sich um ein hochpolymeres
Molekül. Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt.
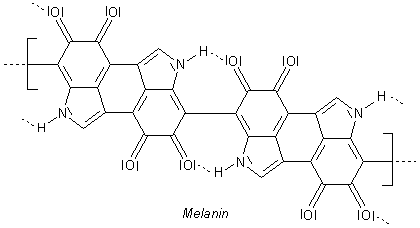
Das Molekül ist mehr oder weniger planar gebaut; man kann es sich als Band vorstellen Dazu tragen die Wasserstoffbrücken
zwischen dem Pyrrol-N und dem jeweils gegenüber liegenden Carbonyl-O bei. Der riesige Chromophor enthält eine Unmenge an leicht
anregbaren π–Elektronen, die über konjugierte Doppelbindungen in mesomere Wechselwirkungen treten können. Auf diese Weise
wird quasi das gesamte sichtbare Licht, das einfällt, absorbiert. Deshalb ist die Farbe des Melanins Schwarz-Braun.
Die Biosynthese von Melanin
Gebildet wird Melanin in den Melanozyten. Das sind spezielle Zellen in der Haut, in Haarwurzeln und in den Augen. In
letzteren finden wir Melanozyten in der Aderhaut (Choroidea) sowie in der Iris, woraus sich die jeweilige Augenfarbe ergibt. Die
Menge an Melanin, die gebildet wird, ist genetisch festgelegt. Wenn kein Melanin synthetisiert werden kann, was durch genetische
Defekte möglich ist, gibt es Albinos.
Wie entsteht Melanin?
Ausgangssubstanz für die Biosynthese ist letztlich die essentielle Aminosäure Phenylalanin.
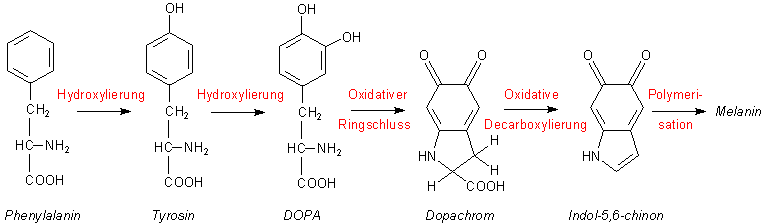
Zunächst wird Phenylalanin hydroxyliert. Die so gebildete Aminosäure Tyrosin wird erneut hydroxyliert.
So entsteht das 3,4-Dihydroxy-Phenylalanin (DOPA). Es folgt ein oxidativer Ringschluss, wobei sich das rote Indol-Derivat
Dopachrom bildet. Spontane Decarboxylierung und anschließende Polymerisation führen zu Melanin. In den Zellen
liegt es gebunden an Proteinen vor.
Die Melanin-Biosynthese ist quasi die Antwort unserer Haut auf zu starke Sonneneinstrahlung
Menschen, die wenig Melanin oder wie Albinos gar keines bilden, haben schlechte Karten. Denn die Melanin-Bildung schützt unsere
Haut vor zu starker Sonneneinstrahlung. Das ist vor allem wichtig in Zeiten des Abbaus von stratosphärischem
Ozon. Ozon ist unser wichtigster natürlicher UV-Filter. Das betrifft vor allem das
UV-C, also den Spektralbereich 200-280 nm. Aber auch UV-B (215-315 nm) erzeugt noch Sonnenbrand.
Die „gesunde“ Bräunung erfolgt im Allgemeinen durch die UV-A Strahlung (315-380 nm). Oberhalb von 380
nm beginnt der sichtbare Spektralbereich des Lichts (VIS-Bereich), der kaum Einfluss auf die Melaninbildung hat.
Zum „UV-ABC“ haben wir eine spezielle Webseite.
Melanin hat aber auch eine medizinisch dunkle Seite: Bei zuviel Sonnenstrahlung bildet sich leicht Hautkrebs. Berüchtigt sind die Melanome. Die bestehen aus Melanozyten, sind folglich dunkel gefärbt und heißen deswegen Schwarzer Hautkrebs. Auslöser kann ein Sonnenbrand sein. Man sollte sich also vor zuviel UV-Strahlung schützen, vor allem aus dem UV-B-Bereich. Damit sind wir bei den Sonnenschutzmitteln. Wie sind die zusammengesetzt und wie wirken die? Klicke hier.
Auch Tintenfische produzieren melaninartige Verbindungen
Ein Beispiel ist der braune Farbstoff Sepia. Der ist nach der Tintenfisch-Art Sepia benannt. (Aus
denen werden bekanntlich die leckeren Tintenfischringe geschnitten.)
Weiter sind Reptilien zur entsprechenden Biosynthese fähig. Wie auch die Tintenfische können viele Reptilien (wie das sagenhafte Chamäleon) rasch ihre Farbe verändern. Dabei werden aber nur die farbtragenden Zellen vergrößert oder verkleinert. Gesteuert wird das durch ein Wechselspiel von den Hormonen MSH (melanozyten-stimulierendes Hormon) und Melatonin, die im Gehirnbereich (Hypophyse bzw. Epiphyse) produziert werden.
Im Menschen haben diese Hormone gänzlich andere Aufgaben. Stellen Sie sich einmal vor, wenn entsprechende Veränderungen der Hautfarbe auch bei den Menschen möglich wären!
Wie funktioniert das Bräunen mit dem Saft der Walnussschale?
Wenn das Bräunen mangels Sonneneinstrahlung ausbleibt, kann man sich auch mit dem Saft von frischen, grünen Walnussschalen einreiben.
Der Farbstoff ist kein Polymer, sondern ein kleines Molekül. Er heißt Juglon.
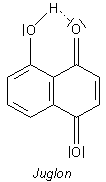
Es handelt sich um ein Hydroxy-naphthochinon. Das ist ein Isomeres vom Hennafarbstoff Lawson.
Beide werden stark von Proteinen adsorbiert, haften also gut am Keratin der Haut und der Haare. Das weiß jeder, der schon einmal frische,
grüne Walnüsse geschält hat.
Rüdiger Blume
Literatur:
[1] W. Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch. de Gruyter, Berlin (neueste Auflage).
[2] W. Kratzert, R. Peichert: Farbstoffe. Quelle und Meyer. Heidelberg 1981.
[3] E. Buddecke: Grundriss der Biochemie. Walter de Gruyter-Lehrbuch. Berlin 1971.
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 25. Juni 2015, Dagmar Wiechoczek