Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie
Tipp des Monats Februar 2025 (Tipp-Nr. 329)
Beim Experimentieren den Allgemeinen
Warnhinweis
unbedingt beachten.
Dennis Dietz
Das Anzünden von Kerzen gehört für viele Menschen zum alltäglichen Leben dazu. Kerzen wecken das Gefühl
von Geborgenheit, können beruhigen und sogar Trost spenden. Außerdem bereiten Kerzen spirituell auf
Weihnachten vor, bspw. in einem Adventskranz. Mit der Zeit brennt jedoch jede Kerze ab und muss
irgendwann ausgetauscht werden. Bild 1: Abgebrannte Kerze in der Weihnachtszeit
Als meine Töchter in der Weihnachtszeit unsere abgebrannten Adventskerzen sahen, machten sie mir einen
interessanten Vorschlag: Ich solle unsere Kerzen doch einfach vor dem Entzünden in den Kühlschrank
stellen. Was kalt ist, brauche doch schließlich länger, um zu verbrennen. Diesem Vorschlag sind wir
umgehend gemeinsam experimentell nachgegangen. Wenn das feste Wachs zunächst kälter ist, dann sollte sich theoretisch die Zeit bis zum Phasenübergang
von fest nach flüssig erhöhen und die Kerze somit länger brauchen, um „abzubrennen“. Gleichzeitig müsste
sich jedoch die Helligkeit der Flamme verringern, da weniger Kerzenwachs in der gleichen Zeit schmilzt,
verdampft und schlussendlich verbrennt. Ob diese beiden Effekte so groß sind, dass sie von praktischer
Relevanz sind, haben wir in einem Modellversuch experimentell untersucht. Versuch: Untersuchung der Brenndauer von Kerzen in Abhängigkeit von deren
Ausgangstemperatur Zunächst werden Teelichter des gleichen Herstellers gewogen und jeweils gleich schwere
Teelichter zu Paaren zusammengestellt. Im Anschluss wird jeweils eines der beiden paarigen
Teelichter für mindestens 24 Stunden in das Tiefkühlfach gelegt. Nach dieser Zeit werden die
Teelichter aus dem Tiefkühlfach entnommen und gleichzeitig mit dem jeweils zweiten Teelicht, das
bei Raumtemperatur gelagert wurde, entzündet. Es wird die Zeit bestimmt, bis die beiden
Teelichter abgebrannt sind. Nachdem die Teelichter ausgegangen und abgekühlt sind, werden sie
ein zweites Mal gewogen.
Insgesamt wird die Brennzeit von jeweils drei Teelichtern, die für 24 Stunden entweder im
Tiefkühlfach oder bei Raumtemperatur gelagert wurden, gemessen und miteinander verglichen. Bild 2: Teelichter unterschiedlicher Ausgangstemperatur nach einer
Brenndauer von 15 Minuten
Beobachtung: Die Teelichter, die im Tiefkühlfach gelagert wurden, sehen an
wenigen Stellen rissig aus. Innerhalb der ersten halben Stunde des Abbrennens ist deutlich zu
erkennen, dass sich beim jeweils „tiefgekühlten“ Teelicht weniger flüssiges Wachs um den Docht
herum gebildet hat, als beim Teelicht, das zuvor bei Raumtemperatur gelagert wurde. Ein
Unterschied in der Größe der Flamme ist jedoch mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Es kann aber
beobachtet werden, dass die bei Raumtemperatur aufbewahrten Teelichter deutlich schneller
abbrennen, als die Teelichter, die für 24 Stunden ins Tiefkühlfach gelegt wurden. Bild 3: Das bei Raumtemperatur aufbewahrte Teelicht brennt deutlich
schneller ab.
Die gemessenen Massen der Teelichter vor (m1) und nach (m2) dem Abbrennen
und die jeweiligen
Brenndauern (t) sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Tab. 1: Tabellarische Darstellung der Messwerte aus der experimentellen
Bestimmung der Abhängigkeit der Brenndauer eines Teelichts von dessen Ausgangstemperatur
Wie der Tabelle 1 eindeutig zu entnehmen ist, ist die Brenndauer von Teelichtern, die vorab im
Tiefkühlfach gelagert wurden, deutlich höher, als von Teelichtern, die bei Raumtemperatur aufbewahrt
wurden.
Die didaktischen Potenziale des hier dargestellten Experiments für den naturwissenschaftlichen
Anfangsunterricht sind enorm:
Die Schüler*innen können das experimentelle Vorgehen selbst planen und – wenn notwendig – ihre Planungen
auch zuhause umsetzen, ohne dass eine Gefahr für ihre Sicherheit gegeben wäre. Außerdem können die
Schüler*innen sowohl das Prinzip der Variablenkontrolle als auch erste Fehlerbetrachtungen systematisch
erlernen bzw. vertiefend üben. Danksagung:

(Foto: Dietz)
Die brennende Kerze – ein Klassiker aus dem
Anfangsunterricht
Die brennende Kerze ist wahrlich ein Klassiker aus dem naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht,
wie man u.a. in Schulbüchern nachvollziehen kann [z.B. 1, S. 110]. Sowohl in Schulbüchern als auch im
Internet findet man zahlreiche Versuchsanleitungen rund um brennende Kerzen, bspw. vom
Lehrerfortbildungszentrum Chemie der Universität Rostock [2]. Warum Kerzen überhaupt brennen und
Vorschläge dazu, was man experimentell mit Kerzen alles so anstellen kann, hat auch Prof. Blume bereits
in der Vergangenheit umfassend beschrieben.
Viele Kerzen bestehen hauptsächlich aus Paraffin, einem Gemisch aus acyclischen, gesättigten
Kohlenwasserstoffen mit der allgemeinen Summenformel CnH2n+2 und n ≈ 18-32 [3].
Das Kerzenwachs
schmilzt, steigt aufgrund der Kapillarwirkung im Docht hoch, verdampft und verbrennt schließlich.
Zur experimentellen Überprüfung: Brennen „tiefgekühlte“ Kerzen“
wirklich länger?
Für unseren Modellversuch war es notwendig, auf das Prinzip der Variablenkontrolle zu achten. Wir
benötigten Kerzen, die aus dem gleichen Kerzenwachs (Paraffinwachs + identische Zusatzstoffe) bestehen
und in Größe und geometrischer Form identisch sind. Außerdem sollten die Kerzen recht klein sein, um die
Brenndauer in einem für das Experimentieren angemessenen zeitlichen Rahmen zu halten. Aus diesen Gründen
haben wir uns entschieden, klassische Teelichter eines festgelegten Herstellers miteinander zu
vergleichen.
Um sicherzustellen, dass mögliche Unterschiede in der Brenndauer nicht auf unterschiedliche Mengen an
Kerzenwachs in den Teelichtern zurückzuführen sind, haben wir die Teelichter sowohl vor als auch nach
dem Abbrennen gewogen. Zur Untersuchung des Einflusses der Ausgangstemperatur des Wachses auf die
Brenndauer haben wir Teelichter der gleichen Masse zu Paaren zusammengestellt und jeweils eines der
beiden Teelichter für 24 Stunden in das Tiefkühlfach gelegt, bevor wir beide Teelichter zur gleichen
Zeit entzündet haben. Die Brenndauer der Teelichter haben wir mit einer Stoppuhr bestimmt.
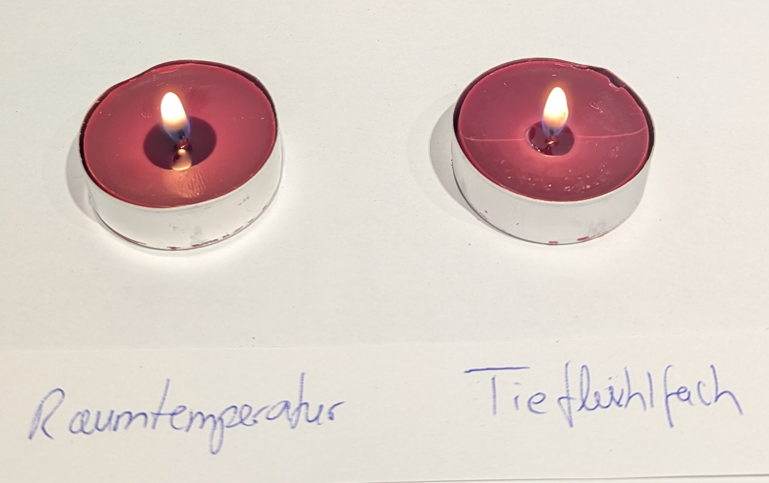
(Foto: Dietz)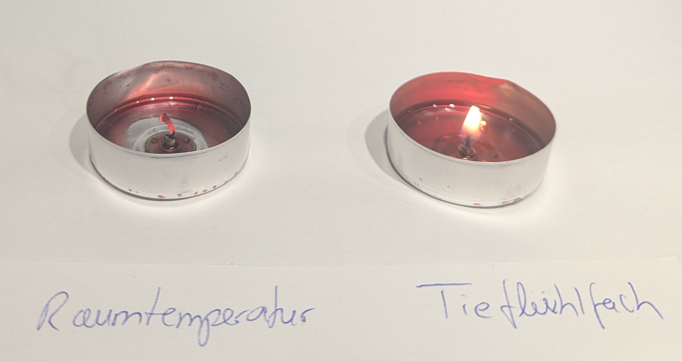
(Foto: Dietz)
Starttemperatur in °C
Masse m1 in g
Masse m2 in g
Massendifferenz Δm in g
Brenndauer t in min
Kerzenpaar 1
20
12,0
1,2
10,8
237
Kerzenpaar 1
-17
12,0
1,2
10,8
267
Kerzenpaar 2
20
12,2
1,2
11,0
248
Kerzenpaar 2
-17
12,2
1,2
11,0
278
Kerzenpaar 3
20
12,0
1,2
10,8
239
Kerzenpaar 3
-17
12,0
1,2
10,8
268
Fazit
Die Brenndauer von Kerzen kann tatsächlich dadurch erhöht werden, dass diese vorab im Tiefkühlfach
gelagert werden. Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass die Kerzen infolge der Tiefkühllagerung optisch
weniger ansprechend aussehen könnten.
Eine kleine Leseempfehlung zum Schluss: Der berühmte Naturwissenschaftler Michael Faraday hat sich
bereits im 18. Jahrhundert intensiv mit Kerzen auseinandergesetzt und im Zusammenhang mit dem
Unterrichten von Kindern festgestellt, dass „[e]s keine bessere, keine offenere Tür [gäbe], durch
die
man in das Studium der Naturphilosophie eintreten kann, als wenn man die physikalischen Phänomene
einer
Kerze betrachtet“ [4, S. 10, übers. d. A.]. Diese Aussage kann ich mit Blick auf die zu
beobachtende
Freude, die meine Töchter beim Experimentieren empfunden haben, definitiv bestätigen. Weitere spannende
Erkenntnisse aus den Arbeiten von Michael Faraday kann man in seinem Werk „The Chemical History of a
Candle“ nachlesen.
Ich danke meinen kleinen Experimentatorinnen Marie und Emma sowohl für die Idee als auch für die
gemeinsame Freude beim Experimentieren in der Weihnachtszeit für diesen Monatstipp.
Literatur:
[1] Arnold, K. et al. (2018). Fokus Chemie SI Gesamtband. Cornelsen.
[2] https://www.didaktik.chemie.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_MNF/Chemie_Didaktik/Forschung/Sekundarstufe_I/6._Feuer_und_Flamme.pdf,
letzter Zugriff: 28.12.24
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Paraffin#:~:text=Paraffin%20ist%20leichtfl%C3%BCssig%2C%20%C3%B6lig%20oder,%2C%20Versiegelung%2C%20Pflege%20und%20Konservierung,
letzter Zugriff: 28.12.24
[4] Faraday, M. (2002). The Chemical History of a Candle. Dover Publications.
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 12. Februar 2025, Fritz Franzke