| Klick mich an! |
 |
| Bild 1: Kautschukbaum in Thailand
(Foto: Daggi) |
Autoreifen halten den Wagen auf der Straße
Experimente:
Versuch: Herstellen von Gummi aus Latex
Versuch: Zerstörung von Gummi durch Ozon
Versuch: Ozon greift ungesättigte Verbindungen an
Versuch: Ruß aus Ethin
Es gibt nur einen Typ von Kraftfahrzeugen, der seine eigene Straße mitbringt: das
Kettenfahrzeug. Alle anderen sind auf fremde Straßen und auf gute Bodenhaftung
angewiesen. Die Berührungszone mit der Straße beträgt nur wenige Quadratzentimeter.
Das Material der Reifen, das Gummi, muss also für gute Haftung
auf den Straßen sorgen. Jeder, der versucht hat, mit Gummischuhen auf einer
trocknen oder auch feuchten Straße zu schliddern, weiß das. Ledersohlen haften viel
weniger.
Warum rutschen Autos auf einer Ölspur?
Ölspuren sind der Schrecken eines jeden Autofahrers. Da fährt man gemütlich vor sich hin,
und da hat ein Heizöltransporter vor einem Öl verloren, weil er zum Beispiel zu schnell in die
Kurve ging und seine nicht richtig geschlossenen Tanks kleckern. Husch! ist man aus der Spur.
Reifengummi ist (wie wir gleich sehen werden) letztlich ein Kohlenwasserstoff. Es ist griffig (in der Werbung hat es seinen "Grip"), weil seine festen Kohlenwasserstoffe mit denen des Straßenbelags wechselwirken. Der Straßenbelag enthält Bitumen. Das ist ein Rückstand der Erdöldestillation. Bei der Wechselwirkung handelt es sich um van der Waals-Bindungen.
Wenn aber Dieselöl oder Heizöl auf die Straße kleckert, löst dieses die feste Bitumendecke an, sie wird rutschig. Jetzt kommt es aber noch dicker: Ein Reifen, der darüber rollt, wird ebenfalls angelöst - beides ergibt ein glitschiges System.
Vergleichen kann man es, wenn man mit einem Schlittschuh über Eis gleitet. Das geht nur, weil sich das Eis unter Druck verflüssigt. Ein Schlittschuh mit "Grip" würde nicht gleiten.
| Klick mich an! |
 |
| Bild 1: Kautschukbaum in Thailand
(Foto: Daggi) |
Was Gummi ist
Hauptsubstanz der Autoreifen ist Gummi. Darunter versteht man vulkanisierte
natürliche oder synthetische Kautschuke. (Die Bezeichnung Gummi kommt von dem
ägyptischen Wort kami für das Harz von Akazien (uns bekannt als gummi
arabicum); Kautschuk kommt vom altspanischen cauchuc, einem Wort
indianischen Ursprungs. Bekanntlich wurde Kautschuk in den Wäldern Südamerikas entdeckt.)
Kautschuk ist zunächst ein biologisches
Polymer, das von Bäumen und Pflanzen zum Wundverschluss hergestellt wird (siehe Bild oben). Es liegt im
Latex gelöst oder besser suspendiert vor.
Die Bausteine des Polymers sind Isoprenmoleküle.
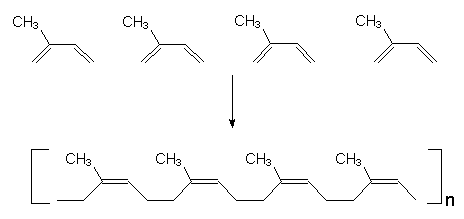
Isopren ———> Kautschuk
Andere, künstliche Kautschuke behalten das Bauprinzip bei; so erhält man sie z. B.
durch Polymerisation von Butadien und dessen Derivaten. Auch Polyacrylate spielen
eine Rolle.
Kautschuk ist weich und klebrig und eigentlich gar nicht zu gebrauchen. Durch Zufall entdeckte der Amerikaner Goodyear, dass Zusatz von großen Schwefelmengen und anschließende Hitzebehandlung die Eigenschaften dramatisch verbessert: Das eigentliche Gummi war geboren.
Bei diesem Vorgang (Vulkanisation) werden im Kautschuk vorhandene lineare Kettenmoleküle durch Schwefelbrücken quer vernetzt (-> Versuch). Dabei bilden sich dichte Knäuel. Beim Dehnen des Gummis werden die Knäuel auseinandergezogen. Lässt man das Gummi wieder los, verknäulen sich die Moleküle erneut. (Lies hier nach.)
Beim Dehnen wird Gummi heiß, wie du selbst mit einem Laborschlauch nachprüfen kannst. Dazu musst du das Gummi an die Wange halten und rasch aufdehnen. Dann ist die Erwärmung deutlich zu spüren.
Je nach Vernetzungsgrad, also Schwefelgehalt, unterscheidet man zwischen Weich- und Hartgummi.
Woraus Reifen bestehen
Reifen bestehen aber schon lange nicht mehr nur aus Gummi. Sie enthalten weitere
Additive, die der Stabilisierung dienen. Ein Beispiel ist Zinkoxid. Zum Färben greift man
auf Ruß zurück. Weiße Reifen enthalten Titandioxid.
Ruß gewinnt man durch Verbrennen von Ethin unter Luftmangel (->
Versuch),
heute vor allem durch Cracken von Methan und anderen Kohlenwasserstoffen, zunehmend
aber auch aus Altreifen (-> Versuch).
Stahlgürtel halten die Reifen auf der Felge und sorgen auch für mechanische
Stabilität.
Hochleistungskunststoffe verstärken das Gummi.
Stickstoffhaltige Beispiele sind Kevlar oder Nylon.
Das ganze erstaunliche Innenleben eines Reifens offenbart sich dem Laien allerdings erst dann, wenn der Reifen platzt.

Bild 2: Geplatzter Lkw-Reifen
(Foto: Blume)
Gummi und Ozon
Es wird gegenwärtig zunehmend beobachtet, dass Gummireifen und Gummidichtungen
immer schneller altern. Grund ist, dass Ozon Gummi zerstört.
Besonders rasch reagiert Ozon mit gestrecktem Gummi
wie in Autoreifen, die unter hohem Druck stehen. Aber
auch aufgeblasene Luftballons sind so gefährdet, dass man mit ihnen sogar Ozon
nachweisen kann (-> Versuch).
Ozon spaltet die Doppelbindungen des Kautschuks unter Bildung von Carbonsäuren. Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass die Struktur von Kautschuk durch C. Harries im Jahre 1904 mit Hilfe der Ozonbehandlung aufgeklärt werden konnte. Die Reaktion kann man auch mit niedermolekularen Verbindungen zeigen (-> Versuch).
Gummientsorgung
Altgummi fällt in sehr großen Mengen an. So müssen jährlich um die
50 Millionen Altreifen entsorgt werden. Verbrennen kann man es nicht, da sehr viel Ruß,
aromatische Kohlenwasserstoffe und andere ölhaltige Produkte sowie
Schwefeldioxid freigesetzt werden. Deshalb hat man gerade für Gummi eine ausgefeilte
Recyclingtechnik erarbeitet.
Weitere Texte zum Thema „Auto“