| Brenzkatechin ortho-Dihydroxybenzol |
Resorcin meta-Dihydroxybenzol |
Hydrochinon para-Dihydroxybenzol |
 |
 |
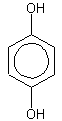 |
Die reduzierende Wirkung der zweiwertigen Phenole - Chinone
Experimente:
Versuch: Reduktion von Fehling-Reagenz durch Dihydroxybenzole
Experimente mit Brenzkatechin
Versuch: Die Bildung von Chinhydron
Von den zweiwertigen Phenolen (Benzolring mit zwei OH-Substituenten) gibt es drei Stellungsisomere:
Brenzkatechin, Resorcin und Hydrochinon. Sie zeigen viele
Unterschiede in ihren chemischen Eigenschaften, obwohl sie alle dieselbe Bruttoformel aufweisen. Der
Grund hierfür ist die unterschiedliche Anordnung der zwei OH-Gruppen in den Molekülen.
| Brenzkatechin ortho-Dihydroxybenzol |
Resorcin meta-Dihydroxybenzol |
Hydrochinon para-Dihydroxybenzol |
 |
 |
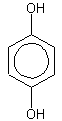 |
Eine der auffälligsten Eigenschaften der zweiwertigen Phenole ist die unterschiedliche Oxidierbarkeit. Brenzkatechin und Hydrochinon sind gute Reduktionsmittel. So reagieren sie beispielsweise mit dem bekannten Fehling-Reagenz schon in der Kälte (-> Versuch). Dabei wird das im Komplex gebundene Kupfer(II) zu ziegelrotem und in Wasser schwer löslichem Kupfer(I)-oxid reduziert, während Brenzkatechin und Hydrochinon in die entsprechenden Chinone übergehen:
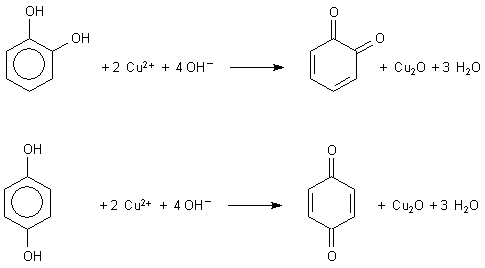
Wegen ihrer reduzierenden Eigenschaft werden Brenzkatechin und Hydrochinon als fotografische Entwickler eingesetzt.
Resorcin dagegen ist ein viel schwächeres Reduktionsmittel. Es reduziert Fehling-Reagenz erst nach Erhitzen.
Der Grund für das unterschiedliche Reaktionsverhalten der drei isomeren zweiwertigen Phenole liegt darin, dass Resorcin als meta-Verbindung (anders als para- oder ortho-Verbindungen) kein Chinon bilden kann und somit unter hohem Energieaufwand der Benzolring oxidativ geöffnet werden muss.
Bemerkenswert ist beim Hydrochinon noch die Bildung von Chinhydron, einem typischen Vertreter der Charge-Transfer-Komplexe (CT-Komplexe).
Chinone bzw. Verbindungen mit chinoider Struktur spielen auch in der Farbstoffchemie eine wichtige Rolle. Im Schulalltag bekannt ist das Dichlorphenol-Indophenol (DCPIP), bekannt unter der Bezeichnung "Tillmanns Reagenz". Aber auch Stoffe aus der Triphenylmethanreihe sind hier zu nennen. Der bekannteste dürfte das Phenolphthalein sein.
Weitere Texte zum Thema „Phenole“