Prof. Blumes Tipp des Monats November 2012 (Tipp-Nr. 185)
Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis
unbedingt beachten.
Färben mit der Färber-Hundskamille
Unsere im Übergangsgebiet zwischen der sandigen Senne und dem Kalksteinrücken des Teutoburger Waldes gelegene Umgebung bringt viele Naturschönheiten hervor. Dazu gehört auch eine gelbe, aromatisch duftende Kamille-Art, die in einer Sandgrube mit Kalksteineinstreuungen „wohnt“.
Klick mich an!
Bild 1: Färber-Hundskamille
(Foto: Blume)
Diese Pflanze wird als relativ selten eingestuft. Ich weiß aber nach einigen Recherchen, dass man diese Pflanze
mittlerweile regelrecht kultiviert. Was ist der Grund dafür? Die schöne, sattgelbe Farbe der Blüten lässt einen Betrachter
gleich an die Verwendung als Farbstoff denken.

Bild 2: Blüten der Färber-Hundskamille
(Foto: Blume)
Die Blume heißt ja schließlich nicht umsonst Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria).
Kann man damit wirklich färben? Das wollen wir jetzt
untersuchen
Zunächst stellen wir eine Lösung des Farbstoffs her. Die Lösung nennt man Färberflotte.
|
Versuch 1: Herstellen der Färberflotte
|

Bild 3: Herstellen einer Flotte der Färber-Hundskamille
(Foto: Blume)
Nun müssen wir eine Strategie zum Färben entwickeln. Dazu benötigen wir Informationen zu den chemischen Eigenschaften
des gelben Farbstoffs.
Er gehört zu den Flavonen (lat. flava, gelb). Das sind oxidierte Verwandte der Anthocyane. Sein Name ist Apigenin.
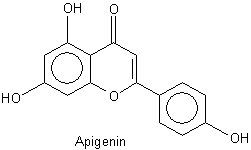
Legen wir die zu färbende Stoffprobe erst einmal direkt in die Färberflotte. Als Stoff haben wir Baumwolle gewählt.
Genau genommen handelt es sich um Stücke von einem ausrangierten T-Shirt.
|
Versuch 2: Direktfärben mit der Färber-Hundskamille
|

Bild 4: Ergebnis von Versuch 2
(Foto: Blume)
Vielleicht hilft uns die Information weiter, dass es sich bei dem Farbstoff Apigenin um ein Polyphenol
handelt. Da erinnern wir uns, dass man für diese Stoffklasse (zu der auch Alizarin gehört) einen
„Haftvermittler“ zwischen Farbstoff und Faser benötigt. In diesem Falle sind das die Ionen dreiwertiger Metalle
wie Aluminium, Eisen oder Chrom. Das Stichwort lautet Beizenfärbung.
Zuhause haben wir von den Versuchen zur Kristallzüchtung noch Kristalle von Kaliumaluminiumalaun KAl(SO4)2 · 12 H2O herumliegen. (Man kann natürlich ein paar Gramm von Opas Rasierstein abkratzen...) Damit können wir die Beizenlösung herstellen.
|
Versuch 3: Beizenfärbung mit der Färber-Hundskamille
Bild 5 (Foto: Blume) Ergebnis: Die Stoffprobe ist diesmal sattgelb geworden (→ Bild 6). |

Bild 6: Ergebnis von Versuch 3
(Foto: Blume)
Jetzt endlich erhalten wir das satte Gelb, das die Färber-Hundskamille für uns bereithält.
Was lernen wir daraus?
Man kann eigentlich alles, was bunt und einigermaßen löslich ist, zum Färben verwenden. Oder man sollte es zumindest versuchen…
Das wäre doch etwas für einen naturverbundenen, forschenden Chemie-Unterricht.
Last but not least
Sie sagen, dieser Tipp käme zu spät - oder bei Ihnen wächst die Färber-Hundskamille nicht. Man kann die getrockneten Blüten jedoch
kaufen. Geben Sie den Namen der Blume in Internet-Suchmaschinen ein. Da wird Ihnen geholfen.
Rüdiger Blume
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 30. Oktober 2012, Dagmar Wiechoczek

