 |
| Bild 1: Ein Alpengewitter zieht auf
(Foto: Blume) |
 |
| Bild 1: Ein Alpengewitter zieht auf
(Foto: Blume) |
Auch Gewitter sind wichtig für das Leben auf der Erde
Experimente:
Versuch: Der biegsame Wasserstrahl
Zu den prächtigsten und beeindruckendsten Naturerscheinungen der Erde gehören
die Gewitter und die Blitze. Ihre Donner sind das lauteste natürliche Geräusch auf der
Erde, ihre 30 000 °C die höchste Temperatur. Und dabei ist der Blitz nicht mehr als
ein elektrischer Funken, wenn auch zugegebenermaßen ein recht großer.
Viele Menschen haben Angst vor Gewittern. So wie Kemmlers Regele, eine
Bauersfrau aus einem Dorf bei Tübingen: Wenn ein Gewitter aufkam, kleidete sie sich
(auch nachts) an, setzte sich in die Mitte der Küche auf einen Stuhl und las laut
Bibelverse vor. Angst vor Gewittern braucht man jedoch nicht zu haben; aber Respekt
sollte es schon sein, vor allem dann, wenn man sich im Freien aufhält.
Wie es zur Aufladung kommt
Wie Gewitter entstehen, weiß man noch nicht genau. Wer laboriert schon gerne in
einer Gewitterwolke? An ihrer Entstehung ist jedoch das Wasser maßgeblich beteiligt.
Gehen wir von der Atmosphäre aus. Durch Sonneneinstrahlung gibt es Ionisierungen.
Die oberen Schichten laden sich stärker auf als die unteren. Normalerweise gleicht
sich das Ladungsgefälle zwischen Erdoberfläche und den verschiedenen Schichten
ständig aus, indem sich ein Stromfluss ausbildet.
An heißen Tagen oder bei Kontakt von extrem heißen und kalten Luftschichten türmen
sich die Gewitterwolken auf. Die können über 12 km hoch werden. Oben stoßen sie an
die kalten Schichten der Stratosphäre, es bildet sich die typische
Ambosswolke.
 |
| Bild 2: Gewitteramboss, fotografiert aus 12 000 m Höhe
(Foto: Blume; Türkei 2002) |
Durch den Temperaturgradienten kommt es zu starken auf- und
abwärtsgerichteten Strömungen. Sie stellen insgesamt einen Generator dar, der den
natürlichen Ladungsausgleich der Atmosphäre aus dem Gleichgewicht bringt.
Schlagartige Entladungen sind die Folge.
 |
 |
| Bild 3: Hagelschauer bei einem Aprilgewitter
(Fotos: Blume) |
Wie es nun zum Aufbau der elektrischen Felder kommt, ist nicht ganz klar. Erinnern
wir uns an den Dipolcharakter der Wassermoleküle
(-> Versuch). Wichtig für die
Blitzentstehung scheinen auch die Eiskristalle zu sein. Diese bilden sich ausreichend
in den Gewitterwolken, wie der Hagel zeigt, der viele Gewitter begleitet. Wenn diese
beim Reiben zerschlagen werden, gibt es Aufladungen. Man hat beobachtet, dass die
leichteren Bruchstücke positiv geladen sind, die schweren negativ. Dadurch kann es
schon zu Ladungstrennungen in der Wolke kommen. Aufladungen beobachtet man
auch, wenn Eiskristalle raschen Temperaturwechseln unterworfen werden. Dafür
spricht, dass die Gewitter umso heftiger sind, je höher die Wolken steigen.
Der entstehende Blitz schafft sich zunächst einen Kanal aus hochionisierter Materie.
Dieser unsichtbare Leitblitz nähert sich der Erdoberfläche. (Im Gebirge spürt man
förmlich die Aufladung der Umgebung! Dann heißt es Deckung nehmen!) Plötzlich
wird die Hochspannungsleitung kurzgeschlossen. Die Ladungen vereinigen sich, es
kommt zum Aussenden von Licht. Dabei wird die umgebende Luft schlagartig
aufgeheizt. Die daraus resultierende Schockwelle bewirkt einen lauten
Überschallknall.
Wie Gewitter Pflanzen düngen
Gewitter haben einen wichtigen Aspekt für das Leben auf der Erde: Sie versorgen die
Pflanzen mit Stickstoffdünger!
Vielleicht hast du schon einmal gerochen, wenn ein Blitz in der Nähe eingeschlagen
hat. Es scheint nach Chlor zu riechen. Das sind aber die reaktiven Stickoxide,
die wir unter der Bezeichnung NOx zusammenfassen. Bei den hohen
Temperaturen der Blitze findet Luftverbrennung statt.
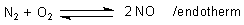
Mit dem Regenwasser und Sauerstoff der Luft wird aus den Stickoxiden Salpetersäure.
2 NO + O2 ———> 2 NO2 /exotherm
2 NO2 + ½ O2 + H2O ———> 2 HNO3 /exotherm
Deren Salze, die Nitrate, sind Düngersubstanzen für Pflanzen. Wenn man bedenkt,
dass weltweit rund um den Globus zu jedem Moment an die 2000 Gewitter toben und
dabei täglich 8 Millionen Blitze entstehen, wird deutlich, dass Gewitter die weitaus
größte Quelle für Stickoxide sind. Diese werden rasch ausgewaschen und für
Pflanzen verfügbar gemacht.
Die Stickoxide, die wir bei technischen Verbrennungen herstellen, entstehen dagegen
bei jeder Wetterlage, vor allem in Ballungsräumen. Sie sind deshalb viel schädlicher
in ihren Auswirkungen als die (wenn auch in größerem Umfang gebildeten) natürlichen
Stickstoffverbindungen.
Weitere Texte zum Thema „Wasser“