Prof. Blumes Tipp des Monats Juni 2012 (Tipp-Nr. 180)
Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis
unbedingt beachten.
Warum manche Blüten schlecht riechen
Wie heißt es so schön bei Eduard Mörike?
|
Frühling lässt sein blaues Band
|
Wenn man jedoch im Frühling durch den Wald spaziert, riecht es manchmal gar nicht so süß oder rosenhaft. Es duftet vielmehr eher fischig nach zersetztem Urin.
Da fällt einem ein, dass ja gerade Vatertag war… Aber das mit Vatertagsausflügen untrennbar verbundene Pinkeln in den Busch ist mitnichten der Grund, weshalb es in der Natur manchmal nach einem schlecht gelüfteten Schulklo riecht. Man schaue also genauer hin. Meist entdeckt man dann die Geruchsquelle. In unserem Fall ist es ein großer, weiß blühender Busch, die Späte Traubenkirsche (prunus serotina).
Klick mich an!
Bild 1: Traubenkirschenblüte
(Foto: Blume)
Der Uringeruch der Traubenkirschenblüte ist aber eher dezent, wenn man ihn mit anderen Pflanzenblüten vergleicht:
Jetzt beginnt die Blüte der Eberesche, bekannt auch unter der Bezeichnung Vogelbeere.
(Der lateinische Name Sorbus aucuparia erinnert chemische Kenner an den Mehrfachalkohol
Sorbit, der in der Vogelbeere vorkommt.) Deren Blüte riecht ganz besonders penetrant nach Schülerklo.

Bild 2: Blütenstand der Vogelbeere
(Foto: Blume)
Außerdem sei der Gefleckte Aronstab (Arum maculatum)
genannt. (Der Name ist irreführend, denn die Blätter sind nicht immer gefleckt.) Auch dessen Blüte duftet intensiv nach sich zersetzendem Harn.

Bild 3: Blühender Aronstab
(Foto: Blume)
Bekannt sind auch die Düfte vom Wiesenbärenklau (Heracleum spondylium) oder von der
Stinkenden Nieswurz (Helleborus foetidus).
Klick mich an!
Bild 4: Stinkende Nieswurz
(Foto: Blume)
Warum setzen die genannten Pflanzen statt auf süßen, aromatischen Honigduft auf fischigen Geruch? Soll das etwa
Fressfeinde abstoßen? Nein, es ist ganz anders: Die Pflanzen wollen bestimmte Tiere anlocken, denn es handelt sich um einen
genialen Trick, sie zum Bestäuben ihrer Blüten auszunutzen. Man spricht treffend von Chemischer
Mimikry.
Der fischige Geruch stammt von den Aminen
Aminen gemeinsam ist die intensive Duftnote nach zersetzter, proteinhaltiger Biomasse, ganz besonders nach Urin/Harn,
Fäkalien und Aas. Damit erkennen wir schon die Zielgruppe, die die Pflanze mit diesem Duft anlocken will: Es handelt sich um
Aas oder Dung vertilgende Organismen wie z. B. die Dungfliege, die vom Duft angezogen die Pflanzenblüte besucht und
diese - wie vorgesehen - dabei bestäubt. Aber auch spezielle Dungkäfer sind betroffen.
Dabei bedient sich der Aronstab eines besonderen Tricks: Er steigert im Moment des Öffnens seiner Blüte die Temperatur des Innenraums auf über 30 °C. Das fördert das Verdampfen der Amine.
Es gibt etwa hundert biogene Amine, die in der Natur eine Rolle spielen. Amine stellen die Pflanzen im Wesentlichen durch Decarboxylierung aus Aminosäuren her. Hier zum Beispiel ist die Reaktion der Aminosäure Glycin, die zur Bildung von besonders fischig riechendem Methylamin führt.
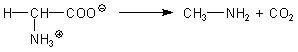
Amine riechen nicht nur fischig: Manche „duften“ nach Aas oder Fäkalien. Die Duftnoten können noch variieren, indem die
Amine N-methyliert werden.
Die folgende Tabelle zeigt einige der wichtigsten biogenen Amine.
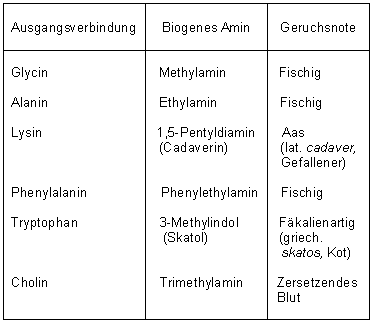
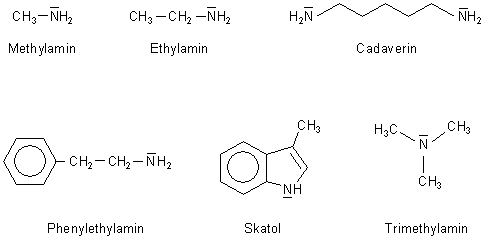
Kann man diese Amine im Chemieunterricht nachweisen?
Leider kaum. Wir haben es versucht, unter entsprechenden Bedingungen Amine in den Blüten zu finden. Das kann man z. B.
dadurch machen, dass man ein feuchtes Indikatorpapier in den Dampfraum eines Gefäßes, in das man die Blüten gelegt hat, hängt.
Denn bei den Aminen handelt es sich um Basen. Wegen der geringen Konzentration bleibt die Reaktion aber aus. Bei der Traubenkirsche
z. B. färbt sich das Papier sogar eher rötlich - und das wegen der Blausäure, die bei der Hydrolyse von Cyanogenen Glykosiden
entsteht.
Wir bleiben aber dran…
Zur Analyse ist eine apparative Ausstattung der Schullaboratorien Voraussetzung, die kaum zu erfüllen ist. Praktiker bedienen sich der Gaschromatografie oder anderer chromatischer Hochleistungsverfahren wie der HPLC sowie der Ionenchromatografie. Das Problem ist nicht nur die Chromatographie, sondern die zuvor notwendige Prozedur zum Aufkonzentrieren der sehr verdünnt vorliegenden Aminmischung.
Auch wenn es nicht gelingt, im Unterricht die Amine chemisch nachzuweisen, so kann man mit den Blüten den Schülern wenigstens einen Eindruck vom Geruch einiger Amine geben.
Zum Schluss
Im Wald wird ohne Ende angelockt: Nach der Blüte produzieren Traubenkirsche, Vogelbeere und Aronstab schöne schwarze bzw.
rote Beeren. Damit werden aber andere Kunden der Pflanzen angesprochen: Diesmal sind es nämlich die Vögel, die willig
die Beeren fressen und den Samen mit ihrem Kot in der Landschaft verteilen.
Wenn Traubenkirsche, Vogelbeere und Aronstab verblüht sind, folgt die ebenfalls äußerst geruchsintensive Stinkmorchelsaison…
Rüdiger Blume
Literatur
[1] J. B. Harborne: Ökologische Biochemie; Spektrum Verlag, Heidelberg 1995.
[2] H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle: Lehrbuch der Lebensmittelchemie; Springer-Verlag, 6. Auflage, Berlin Heidelberg New York 2008.
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 01. Oktober 2012, Dagmar Wiechoczek

