Prof. Blumes Tipp des Monats Januar 2009 (Tipp-Nr. 139)
Beim Experimentieren den Allgemeinen Warnhinweis
unbedingt beachten.
Chemie der Glücksbringer: Fliegenpilze

Bild 1: Traditionelle Glücksbringer zur Jahreswende
(Foto: Blume)
Zu Neujahr werden Gebinde mit Schornsteinfegern, vierblättrigen Kleeblättern und mit
Fliegenpilzen verschenkt. Dahinter steckt viel Alltagschemie – pardon: „Chemie im Kontext“.
| - | Der Schornsteinfeger gilt in der Öffentlichkeit als Glücksbringer, weil er schon seit dem Mittelalter Menschen vor häuslichen Unglücken bewahrt hat: Das betrifft vor allem Kaminbrände, die früher zum Abbrennen ganzer Stadtteile führen konnten. Ursache waren nicht gereinigte Kamine, deren rußige Ablagerungen in Brand gerieten. Manche Kamine waren auch regelrecht verstopft - zum Beispiel durch Vogelnester. Als „Täter“ sind (auch heute noch!) vor allem die Dohlen und Möwen zu nennen. Die Folge war, dass der Kamin nicht mehr „zog“ und es zu Vergiftungen durch Kohlenmonoxid kam. Zum Schornsteinfeger fällt einem deshalb die Chemie um den Kamin ein (Verbrennung). Oder die Grundsubstanz von Ruß: Graphit. Vielleicht interessiert auch, was aus dem Schornstein als Kondensat tropft. Dazu kommen noch die Abgase. |
| - | Begehrt sind auch die vierblättrigen Kleeblätter. Einige Menschen finden immer wieder mal welche vom echten Klee auf dem Acker. Aber die Pflanzen, die man zum Jahresende überall kaufen kann, gehören zur Sauerklee-Gruppe. Unser vierblättriger Glücksklee heißt Oxalis deppei und stammt (wie man dem Namen unschwer entnehmen kann) aus Mexiko. Sauerklee macht nicht nur lustig, sondern enthält die gesundheitlich bedenkliche Oxalsäure. |
| - | Warum sollen Fliegenpilze Glück bringen? Vielleicht ist es nur die lustige rote Farbe der Kappe mit den niedlichen weißen Flecken. Wir könnten uns ja einmal um die Chemie der Pilze kümmern. |

Bild 2: Fliegenpilz im Teutoburger Wald (Foto: Blume)
Da ist zum ersten der wichtige nachwachsende Rohstoff Chitin, das nicht
nur die Gliedertiere herstellen: Auch Pilze bauen ihre Zellwände daraus auf. Weiter sind zu nennen: Farbe und Gifte
der Pilze. Das Thema „Pilze“ ist außerdem für den fächerübergreifenden Unterricht geeignet. So kann man die Biologie
der Pilze studieren. Oder die hygienischen Aspekte ansprechen. Auch in historischer Hinsicht ist einiges zu lernen.
Pilze spielen in vielen Kulturen eine wichtige Rolle.
Woher kommt der Name des Fliegenpilzes?
Seine rote Farbe soll vermeintlich Aasfliegen zur Verbreitung von Sporen anlocken. Das ist aber wohl nicht der Fall.
Der Name könnte auf die Verwendung des Fliegenpilzes als Fliegenfänger zurückzuführen sein. Bei Wikipedia
ist zu lesen: Wie es heißt, schnitt man den Pilz dazu in kleine Stücke und legte sie in stark gezuckerte Milch
ein; Fliegen, die davon tranken, starben nach einiger Zeit. Dazu unten mehr.
Was sind die Farbstoffe des Fliegenpilzes?
Wenden wir uns zunächst dem auffälligsten Merkmal des Fliegenpilzes zu, seiner roten Hutfarbe. Viele Leute meinen
auch heute noch fälschlicherweise, als Farbstoffe kämen die von Tomate (Lycopin) und Karotte (β-Carotin) in Frage.
Um die 1930er Jahre hat man aus den Ergebnissen von vielen chemischen Experimenten für diesen Farbstoff (den man Muscarufin nannte) die folgende Strukturformel hergeleitet.
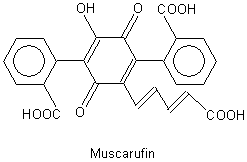
Bild 3: Früher vermutete Struktur des roten Fliegenpilzfarbstoffs
Seit 1975 weiß man es besser. Hier ist zunächst einer der Fliegenpilzfarbstoffe, das Muscapurpurin.
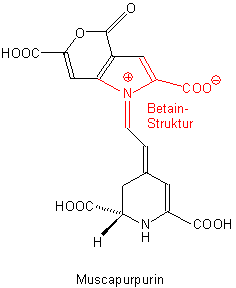
Bild 4: Einer der Fliegenpilzfarbstoffe
Die meisten Farbstoffe des Fliegenpilzes (es gibt mindestens sieben) sind übrigens chemisch verwandt mit dem Farbstoff der Roten Bete, dem Betanin. Sie enthalten alle eine typische, stark polare Konfiguration, die Betainstruktur. Im Bild ist diese Struktur rot eingezeichnet. Ein Betain ist eine Verbindung, die ein vierfach gebundenes („quartäres“) N-Atom (positiv geladen) und ein Säure-Anion (negativ geladen) trägt. Hierzu gehört zum Beispiel auch das Lecithin. Die Farbstoffgruppe nennt man Betalaine.
Die verschiedenen Farbstoffe führen dazu, dass die Fliegenpilze auch unterschiedlich gefärbt sein können. So gibt es Fliegenpilze mit purpurnen, roten oder auch orangefarbenen Kappen.
Hinsichtlich des Wandels der Strukturformeln muss man milde sein: Wenn man genau hinsieht, gibt es durchaus einige Ähnlichkeiten zwischen Muscarufin und Muscapurpurin. Die Analytik war damals um 1930 halt noch nicht so weit wie 1975 oder gar heute (mit Technologien wie dem NMR). Bedenken Sie auch, dass damals nur etwa 250 Milligramm der Substanz zur Verfügung standen!
Fliegenpilze sind nicht nur rot, sondern auch giftig
Das mit der Vergiftung von Fliegen scheint zu stimmen: Eines der Fliegenpilzgifte ist das Muscimol.
Es wirkt nicht nur auf den Menschen, sondern ist auch ein Insektizid.
Seine Vorläufersubstanz ist die Ibotensäure, aus der Muscimol durch Decarboxylierung entsteht. Der Heterocyclus heißt Isoxazol-Ring. Er gehört zu den elektronenreichen Heteroaromaten.
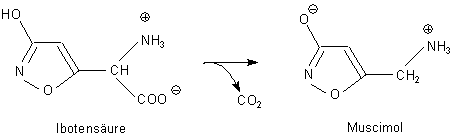
Bild 5: Haluzinogene Substanzen des Fliegenpilzes
Beide Substanzen haben strukturelle Ähnlichkeiten mit der GABA (g-Aminobuttersäure), einem Derivat der Aminosäure Glycin. Das ist eine wichtige Transmittersubstanz im Zentralnervensystem (ZNS). Genau genommen wirkt sie als ein inhibitorischer Transmitter (Ganglienblocker). Sie sorgt im Allgemeinen für Ruhe und Ausgeglichenheit. Die beiden Pilzgifte setzen sich statt der GABA in die GABA-Rezeptoren. Die Folge ist ein Rauschzustand mit Verwirrungen, Sprachstörungen, Müdigkeit und Trägheit, der aber auch mit Tobsuchtsanfällen verbunden sein kann. Hinzu kommt, dass sie (wie Glutamat) als starke Geschmacksverstärker für Salzig wirken. Ibotensäure und Muscimol sind somit alles in allem typische Haluzinogene.
Das ist auch der Grund für ihren Einsatz bei religiösen Kulthandlungen europäischer und asiatischer Nomadenvölker, deren Schamanen sich mit Fliegenpilzen in Rauschzustände versetzt haben sollen. Dass die gelallten und gerallten Weissagungen dieser weisen Männer dann auch nicht so richtig verstanden werden konnten und somit frei interpretierbar waren, hat den Schamanen sicherlich geholfen, ihre Machtpositionen zu behaupten…
Glücklicherweise ist der Fliegenpilz (Amanita muscaria) nicht so extrem giftig wie seine Verwandtschaft, die Gruppe der Knollenblätterpilze - wie zum Beispiel deren grüner Vertreter (Amanita phalloides).
Ob das die Ursache für das Glücklichmachen war? Bekifft, aber nicht tot?
Das stimmt nur bedingt. Man muss nämlich höllisch aufpassen, was die Dosis angeht!
Fliegenpilze enthalten einen Antagonisten zu Acetylcholin
Das eigentliche, gefährliche Gift des Fliegenpilzes heißt Muscarin. Es handelt sich um ein
typisches Alkaloid, das zwar nicht haluzinogen wirkt, aber das vegetative Nervensystem beeinflusst. Dies sind neben
den eben beschriebenen Haluzinationen die charakteristischen Anzeichen einer Fliegenpilzvergiftung:
|
Extrem verengte Pupillen (Miosis)
|
Muscarin besitzt eine polare Struktur, die an die des Neurotransmitters Acetylcholin (AC) erinnert. Der Heterocyclus heißt Oxolan-Ring. Das ist nichts anderes als Tetrahydrofuran, ein gesättigter Heterocyclus, den man auch von der Fructose her kennt.
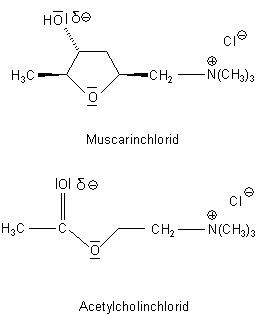
Bild 6: Muscarin und Acetylcholin im Vergleich
Obwohl Muscarin eine Hydroxylgruppe trägt, sind die Polaritäten der beiden Moleküle ähnlich. Außerdem stimmen
die Molekülgeometrien erstaunlich gut überein. Damit kann Muscarin anstelle von Acetylcholin dessen Rezeptoren in den Synapsen
des vegetativen Zentralnervensystems besetzen. Dummerweise sorgt Muscarin für anhaltenden Signalfluss. Denn es wird anders
als Acetylcholin nicht durch die Acetylcholinesterase (ACE) abgebaut.
Die Syndrome der Vergiftung entsprechen folglich denen, die auch bei der Einwirkung von Organophosphorverbindungen auftreten. Diese Ultragifte wirken bekanntlich, indem sie das Acetylcholin abbauende Enzym ACE hemmen.
Deshalb dient Atropin auch bei Vergiftungen mit Fliegenpilzen als Antidot. Atropin ist ebenfalls ähnlich wie Muscarin und Acetylcholin aufgebaut. So kommt es zu einer Verdrängung des Muscarins aus den AC-Rezeptoren. Da Molekülgrößen und Polaritäten doch sehr unterschiedlich sind, unterbindet Atropin den anhaltenden Signalfluss durch die Synapsen des vegetativen Nevensystems.
Zur Giftigkeit des Fliegenpilzes hat uns ein Leser geschrieben. Lesen Sie die Frage 1682.
Rüdiger Blume
Diese Seite ist Teil eines großen Webseitenangebots mit weiteren Texten und Experimentiervorschriften auf Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie.
Letzte Überarbeitung: 07. Februar 2014, Dagmar Wiechoczek